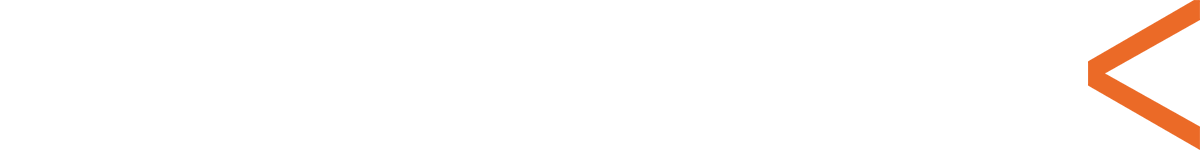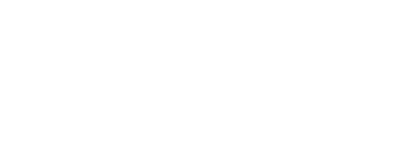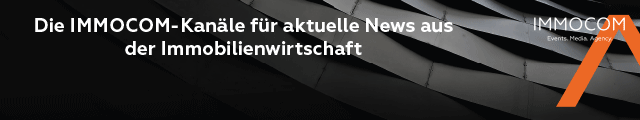Der neue Continentale Campus in Dortmund steht sinnbildlich für die Transformation moderner Arbeitswelten: nachhaltig, digital geplant und konsequent nutzerorientiert umgesetzt. Mit rund 50.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche vereint der Neubau erstmals alle Dortmunder Mitarbeitenden des Versicherungsverbunds an einem Standort – realisiert in enger Partnerschaft mit Drees & Sommer. Im Interview spricht Gesamtprojektleiter Christian Fürwentsches über digitale Zwillinge, bauliche Kreislauffähigkeit und die Herausforderungen eines Projekts, das den Anspruch erhebt, Maßstäbe zu setzen.
IMMOBILIEN AKTUELL (IA): Welche konkreten Herausforderungen ergaben sich bei der Integration von Cradle-to-Cradle-Prinzipien in den Planungs- und Ausschreibungsprozess – insbesondere im Hinblick auf Lieferketten, Materialverfügbarkeiten und baurechtliche Standards?
Christian Fürwentsches (CF): Das C2C-Designprinzip bringt neue Bewertungskriterien mit sich. Anders als bei der energieeffizienten Planung, die weitgehend verstanden wird, befinden sich viele Akteure im Bereich kreislauffähiges Planen und Bauen noch im Lernprozess. Die Entscheidungen müssen sich an neuen Zielen orientieren, was „learning by doing“ erfordert. Es geht um Materialgesundheit, Wiederverwendbarkeit, Rückbaubarkeit und geschlossene Stoffkreisläufe. Diese Anforderungen führen zu einem Umdenken in der bisherigen Planungslogik. Lieferketten und Materialverfügbarkeiten sind weniger hinderlich als oft angenommen. Die Herausforderung liegt in der richtigen Planung und Ausschreibung. Die Umsetzung rückbaubarer Fügetechniken hängt von klar definierten Anforderungen und Prozessen ab. Wenn Planer und Ausschreiber die richtigen Spezifikationen formulieren, können passende Materialien und Techniken eingesetzt werden. Baurechtliche Standards sind teilweise noch nicht vollständig auf die Anforderungen des Cradle-to-Cradle-Ansatzes abgestimmt. Innovative Lösungen und Materialien müssen den geltenden Normen entsprechen, was einen intensiven Dialog mit Behörden erfordert. Es gibt jedoch positive Entwicklungen, sodass baurechtlich künftig ein unterstützender Faktor darstellen wird. Die größte Herausforderung bei der Integration von Cradle-to-Cradle-Prinzipien liegt weniger in der Materialverfügbarkeit oder Lieferkette, sondern in der Veränderung der Planungs- und Ausschreibungsprozesse sowie im Umgang mit neuen Bewertungskriterien. Ein Umdenken und Lernen im Prozess sind unerlässlich, um die Potenziale des kreislauffähigen Bauens voll auszuschöpfen.

IA: Inwieweit wurde das BIM-Modell über die Bauphase hinaus für Betrieb und Facility Management vorbereitet – und welche Anforderungen wurden dabei an die Datenstruktur, den Informationsgehalt und die Übergabeformate gestellt?
CF: Mit Abschluss der Verträge wurde mit allen Planungs- und Baubeteiligten im Rahmen der Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) vereinbart, dass sowohl IFC-Dateien (Open BIM Austauschformat) als auch die nativen Dateien übergeben werden. Die BIM-Modelle bestehen aus Geometrie sowie Informationsgehalt in Form objektbezogener Attribute. Die Geometrie wurde für das FM-Modell mit einer definierten Toleranz an den gebauten Zustand angepasst. Besonders entscheidend für den späteren Betrieb sind jedoch die Attribute: Diese wurden um die spezifische Betriebssicht des Auftraggebers erweitert und enthalten auch Angaben wie beispielsweise Herstellerinformationen und Wartungsintervalle. Ergänzend wurde ein Anlagenkennzeichnungssystem (AKS) integriert. Die Steuerung und präzise Verortung dieser Informationen innerhalb der Datenstruktur erfolgte durch unsere BIM-Manager mithilfe des Information Delivery Manuals (IDM) sowie des modellbasierten Raumbuchs. Dadurch wird sichergestellt, dass die relevanten Daten an festgelegten Stellen hinterlegt werden, was eine Übergabe und Einbindung in das CAFM-System ermöglicht.
IA: Der Campus soll auch im Betrieb nachhaltige Maßstäbe setzen. Wie wurde die Performance des geothermiegestützten Energiekonzeptes modelliert, validiert und auf realistische Betriebsbedingungen hin optimiert?
CF: Der Campus wurde vollständig zoniert und simuliert, um einen validierten Jahreslastgang des Heizbedarfs und des Kühlbedarfs auf unterschiedlichen Temperaturniveaus zu generieren. Dieser Lastgang bildete die Grundlage für die Bewertung der Energiekonzeptvarianten und der detaillierten Anlagensimulation. Dur den Einsatz der kombinierten Gebäude- und Anlagensimulation war die Optimierung von energierelevanten Betriebsparametern sowie der Auslegung des Geotermiefeldes und der Wärmepumpen möglich um die bestmöglichen Ergebnisse hinsichtlich Energiekosten, CO2-Bilanz und Komfort zu erreichen.
IA: Projekte dieser Größenordnung erfordern nicht nur technologische, sondern auch prozessuale Innovationen. Welche übertragbaren Lessons Learned haben sich in Bezug auf Schnittstellenmanagement, interdisziplinäre Zusammenarbeit oder agile Steuerungsansätze ergeben?
CF: Agile Projektmanagement ist meines Erachtens zwingend anzuwenden, um den Herausforderungen eines solchen Großprojektes effektiv begegnen zu können. Wir haben die Planung mit Werkzeugen aus dem Lean Management ins Ziel gesteuert. Der Planung folgte der Versuch über ein Baupartnermodell einen Generalunternehmer zu finden – dieser Versuch ist bei der Continentale gescheitert und wir haben klassisch über eine Ausschreibung einen den GU Vertrag mit Hochtief abgeschlossen. Am Ende gewinnt man solch ein Großprojekt nur als Team. Da kommt es zum einen auf die gute Teamzusammenstellung, zum anderen aber auch auf die Spielregeln im Team an. Die Zusammenstellung des Projektteams ist durch intensive Gespräche und eine gute Strukturierung der Vergaben erfolgt. Die Spielregeln wurden – ähnlich wie im BIM Management – klar formuliert und durch das Projektmanagement konsequent vorgelebt.
IA: Wie wurde der Nutzerfokus – etwa hinsichtlich Raumakustik, Tageslichtversorgung oder klimatischer Innenraumbedingungen – während der Planung konkret messbar gemacht und iterativ in die bauliche Umsetzung integriert?
CF: Die Bedarfsplanung wurde zusammen mit den Nutzern erstellt und beantwortet neben den oben genannten Themen auch noch die Nutzerbedarfe hinsichtlich Nachhaltigkeit, Sicherheit und aller relevanten technischen Anforderungen (IT, Medientechnik etc.). Diese Bedarfsplanung war bis zur Übergabe an die Nutzer – sechs Jahre später – permanent Richtschnur für Planung und Bau. Während der Planung wurden die Parameter der Raumakustik, Tageslichtversorgung und klimatischer Innenraumbedingungen durch planungsbegleitende Simulationen durch das Team von Drees & Sommer abgeglichen und in die Projektziele gesteuert.