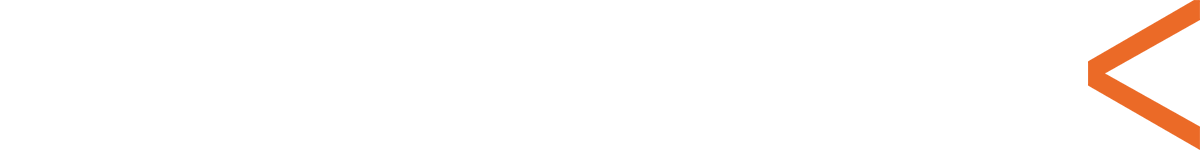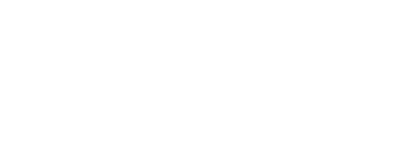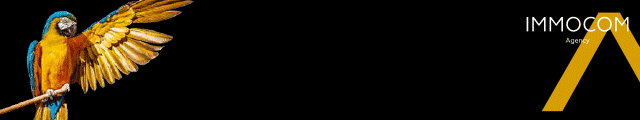Der 76,5 Millionen Euro teure Umbau des Beyer-Baus verbindet Erhalt, Energieeffizienz und Funktionalität. Mit innovativen Materialien wie Carbonbeton und einem präzisen architektonischen Konzept zeigt die TU Dresden, wie aus Geschichte Zukunftsfähigkeit entsteht.
Wer den Beyer-Bau auf dem Campus der Technischen Universität Dresden heute betritt, erlebt ein Stück lebendige Baugeschichte – und zugleich eine überzeugende Antwort auf die Frage, wie denkmalgerechte Bestandssanierung im 21. Jahrhundert aussehen kann. Nach sieben Jahren Bauzeit wurde das traditionsreiche Gebäude, 1913 nach Plänen von Martin Dülfer errichtet, nun vollständig modernisiert und an die Universität übergeben.
Die Aufgabe war komplex: Erhalt der historischen Substanz, Integration modernster Technik und Schaffung zeitgemäßer Lehr- und Forschungsbedingungen. Verantwortlich dafür war die Niederlassung Dresden II des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Finanzminister Christian Piwarz würdigte das Ergebnis als „sichtbares Zeichen für die Verbindung von Tradition und Moderne“. Der Freistaat Sachsen stellte rund 68,3 Millionen Euro der insgesamt 76,5 Millionen Euro Baukosten bereit, weitere 8,2 Millionen Euro kamen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. „Dresden ist Exzellenzuniversität. Dazu gehört aber nicht nur Spitzenforschung, sondern eben auch exzellente Rahmenbedingungen“, so Christian Piwarz in seiner Ansprache. In Vorbereitung dieser habe er gelernt, dass das Gebäude ein „ungenormter Experimentalbau“ war. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow hob hervor, dass „mit dieser Sanierung nicht nur in die Zukunft von Forschung und Lehre investiert, sondern zugleich ein Stück Wissenschafts- und Baugeschichte bewahrt“ werde. Rektorin Prof. Dr. Ursula M. Staudinger würdigte den Beyer-Bau als „Markenzeichen, das uns als Universität Sichtbarkeit bringt“.
2016 hatten die ersten Untersuchungen begonnen, wie eine Restaurierung stattfinden kann, 2018 begannen die Arbeiten. Möbel restauriert, in einem der Hörsäle die Verschattung aus dem Jahr 1913 instandgesetzt. Technisch und konstruktiv galt der Beyer-Bau als Herausforderung. Unterdimensionierte Fundamente, Schadstofffunde und die Notwendigkeit, historische Decken zu ertüchtigen, verlangten nach innovativen Lösungen. Zum Einsatz kam unter anderem Carbonbeton, ein Hightech-Baumaterial, das die Tragfähigkeit erhöht, ohne die Originalstruktur zu beeinträchtigen. Innendämmungen, neue Heiz- und Kühlsysteme sowie eine moderne Datentechnik ergänzen das energetische und funktionale Konzept.
Im Ergebnis entstand ein Hochschulgebäude, das historische Identität mit energetischer Effizienz und funktionaler Zukunftsfähigkeit verbindet. Der neue Südosteingang, der sanierte Turm des Lohrmann-Observatoriums und überdachte Innenhöfe zeigen, wie architektonische Eingriffe sensibel mit Bestand umgehen können, ohne museal zu wirken. Für Uni-Kanzler Jan Gerken ist der Beyer-Bau „ein saniertes Schmuckstück und zugleich ein Symbol für den zukunftsfähigen Umgang mit unserem baulichen Erbe“. Das wiederhergestellte Hubert-Engels-Labor – das älteste Wasserbaulabor Europas – wird künftig als hydromechanisches Lehrlabor genutzt und zeigt exemplarisch, wie historische Forschungseinrichtungen in die Gegenwart überführt werden können.