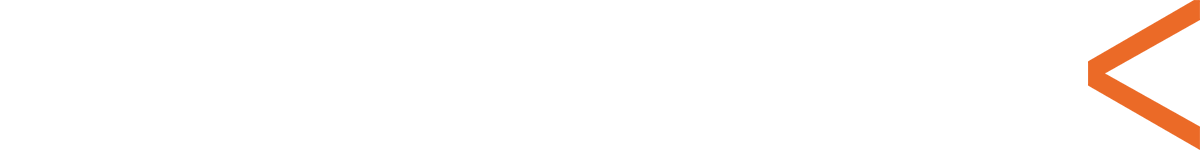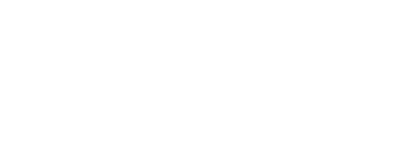Der Deutsche Bundestag hat das „Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“ verabschiedet. Mit dem sogenannten Bauturbo sollen Bauplanungsverfahren vereinfacht, Kommunen mehr Entscheidungsspielräume erhalten und der soziale Wohnungsbau gestärkt werden. Das Gesetz ermöglicht Abweichungen von bestehenden Vorschriften, um etwa Aufstockungen oder die Nutzung innerstädtischer Brachen schneller zu realisieren. IMMOBILIEN AKTUELL fasst die Reaktionen zusammen.
„Wir wollen mehr bauen und wir wollen schneller bauen. Mit dem ‚Bauturbo‘ haben wir ein neues, mutiges Instrument, das unser Land wirklich voranbringen kann“, sagte Bundesbauministerin Verena Hubertz. Gemeinden könnten künftig innerhalb von drei Monaten Bauvorhaben genehmigen und zugleich Anteile für sozialen Wohnungsbau festlegen. Als Allheilmittel taugt das neue Gesetz nicht: „Der Bauturbo ist kein Hebel, an dem wir ziehen und dann fallen Wohnungen vom Himmel. Es kommt drauf an, dass wir alle gemeinsam mitanpacken“, argumentierte die Politikerin im Bundestag. Schon mehrfach bezeichnete Verena Hubertz den Bauturbo als „Angebot für Möglichmacher“. Um Kommunen damit vertraut zu machen, soll es Leitfäden mit Musterbeispielen geben. Wie erwartet stimmte die Opposition gegen das Gesetz. Befürchtet wird beispielsweise mehr Bodenspekulation, die LINKEN warben in der Debatte wie immer für mehr politisch regulierte Mieten.
Aengevelt Immobilien begrüßt den vom Bundestag beschlossenen Bauturbo grundsätzlich als wichtigen Schritt zur Beschleunigung des Wohnungsbaus, bezweifelt jedoch, dass das Instrument in der Praxis ausreichend genutzt werden wird. Nach Einschätzung von Dr. Wulff Aengevelt entfalte das Gesetz nur Wirkung, wenn die Kommunen die neuen Möglichkeiten tatsächlich anwenden – und wenn die Vielzahl beteiligter Behörden effizienter zusammenarbeitet. „Was ist, wenn die Bauaufsicht zwar mitzieht, aber durch andere beteiligte Behörden ausgebremst wird? Wir brauchen deshalb auch eine Synchronisierung der Behörden und Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungsverfahren“, so Wulf Aengevelt.
Auf einer von Aengevelt organisierten Podiumsdiskussion auf der EXPO REAL wurde bereits deutlich, dass viele Experten Zweifel an der tatsächlichen Umsetzbarkeit des Bauturbos haben. Berlin Finanzsenator Stefan Evers betonte, entscheidend sei nicht allein das Gesetz, sondern eine grundlegende Verwaltungsreform, um Zuständigkeiten zu bündeln und Genehmigungsprozesse zu beschleunigen. Auch Stefan Dahlmanns von nyoo by Instone sieht Probleme in der Praxis: Die Verlagerung der Verantwortung auf kommunale Sachbearbeitungsebene könne zu Überforderung und Unsicherheiten führen. Lars von Lackum (LEG Immobilien) äußerte zudem Zweifel, dass sich Verwaltungsmitarbeiter zu risikoreichen Genehmigungen durchringen werden. Neben bürokratischen Hürden bleiben laut Aengevelt die hohen Baukosten ein wesentliches Problem. Axel Gedaschko, Präsident des GdW, verwies darauf, dass rund 70 Prozent der Wohnungsunternehmen derzeit nicht mehr bauen. Nur durch kostensenkende Standards wie den „Hamburg-Standard“ oder den „Regelstandard Erleichtertes Bauen“ in Schleswig-Holstein könne bezahlbarer Wohnraum entstehen.
Zudem erleichtere laut GdW-Präsident Axel Gedaschko das Gesetz die Ausweisung von Flächen, schaffe aber keine Wohnungen. Für echten Fortschritt brauche es digitale Verfahren, weniger Bürokratie, verbindliche Zeitpläne und einen gesellschaftlichen Konsens für mehr Neubau. Entscheidend seien die Kommunen, die den „Schlüssel zum Bauturbo in der Tasche“ hätten. Zudem fordert er wiederholt eine „Fast Lane fürs Wohnen“, also einen rechtlichen Vorrang für Wohnungsbauprojekte. Um Baukosten zu senken, müssten Justiz-, Bau- und Wirtschaftsministerium einfache Bauweisen rechtssicher zulassen, Förderstandards entschlacken und das Vergaberecht modernisieren. Der GdW begrüßt die praxisnahe Anpassungen im Gesetz, etwa bei Aufstockungen und Zustimmungsfristen, mahnt aber: Nur mit mehr Mut, Tempo und politischem Willen lasse sich das Wohnungsproblem wirklich lösen.
„Die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf, etwa zur Klarstellung wirtschaftlicher Belange, zur Differenzierung bei Lärmschutzregelungen oder zur Erweiterung des Anwendungsbereichs des neuen § 246e BauGB sehen wir differenziert. Die Empfehlungen des Bauausschusses enthalten einige sinnvolle Korrekturen am ursprünglichen Entwurf. Doch die zentralen Stellschrauben, insbesondere die nicht einklagbare Zustimmung der Gemeinden, unklare Rechtsbegriffe und die zu kurze Befristung von § 246e BauGB, bleiben unangetastet“, so BFW-Präsident Dirk Salewski.
Kritisch sieht der ZIA als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft das Fehlen einer verpflichtenden Evaluierung. „Ohne bleibt der Bauturbo bloß ein Versprechen. Wir brauchen aber auch einen Tacho, nicht nur das Gaspedal“, so Aygül Özkan, Hauptgeschäftsführerin des ZIA. Der Verband fordert daher eine verbindliche Evaluierungsklausel mit festen Fristen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen und nachsteuern zu können. Skeptisch äußert sich der ZIA auch zur Privilegierung militärischer Vorrangflächen (§ 37a BauGB), da diese kommunale Planungen behindern und Wohnungs- sowie Gewerbebau gefährden könnten. Aygül Özkan mahnt, Verteidigungsinteressen dürften „nicht den Wohnungsbau und Arbeitsplätze auf das Abstellgleis schieben“. Der ZIA fordert klare Begrenzungen, Transparenz und Überprüfungsmechanismen, um eine dauerhafte Blockade von Flächen zu vermeiden. Darüber hinaus drängt der Verband auf Rechtssicherheit beim Gebäudetyp E, um kostengünstiges, effizientes und flexibles Bauen zu ermöglichen. Durch den Verzicht auf nicht zwingende Komfortstandards könnten Baukosten gesenkt und Projekte schneller umgesetzt werden. Langfristig fordert der ZIA eine umfassende Novelle des Baugesetzbuchs, da das derzeitige Planungsrecht aus Sicht der Branche nicht mehr zeitgemäß sei. Der Bauturbo könne nur dann Wirkung entfalten, wenn ihm tiefgreifende strukturelle Reformen folgen.
Der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH) hält den Bauturbo für unzureichend. Zwar enthalte das Gesetzespaket einige sinnvolle Ansätze zur Planungsbeschleunigung, doch bleibe ein zentraler Punkt unberücksichtigt: das Vergaberecht. HDH-Präsident Johannes Schwörer kritisiert, dass die bestehenden Vergaberegeln vorgefertigte Bauweisen benachteiligen – und damit ausgerechnet jene Verfahren, die besonders schnell und klimafreundlich sind. „Das aktuelle Vergaberecht benachteiligt vorgefertigte Bauweisen, die zu über 80 Prozent im Holzbau geschehen. Das hemmt den schnellen und klimafreundlichen Wohnungsbau, den wir dringend benötigen“, so Johannes Schwörer. Der Verband fordert daher, den sogenannten Losgrundsatz zu flexibilisieren, ohne den Mittelstandsschutz aufzugeben. Öffentliche Auftraggeber müssten die Möglichkeit erhalten, Gesamtvergaben vorzunehmen, wenn dies wirtschaftlich oder technisch sinnvoll ist. Nur so könne das Potenzial serieller und modularer Holzbauweisen voll ausgeschöpft werden. Diese sparen durch standardisierte Planung und Vorfertigung von Bauteilen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten – ein entscheidender Beitrag, um mehr bezahlbaren Wohnraum klimafreundlich zu schaffen.
Das will der Bauturbo
Der sogenannte Bauturbo soll die Planungs- und Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau deutlich beschleunigen. Ziel des Gesetzes ist es, Kommunen mehr Handlungsspielraum zu geben, um schneller und mit weniger bürokratischen Hürden neuen Wohnraum zu schaffen. Herzstück ist der neue § 246e Baugesetzbuch (BauGB), der es Gemeinden erlaubt, in bestimmten Fällen vom geltenden Bauplanungsrecht abzuweichen – etwa ohne ein vollständiges Bebauungsplanverfahren durchzuführen. So sollen insbesondere Aufstockungen, Nachverdichtungen und Umnutzungen innerstädtischer Flächen erleichtert werden. Das Gesetz gilt zunächst befristet bis Ende 2030.
Neben der Beschleunigung der Verfahren beinhaltet der Bauturbo auch den Schutz bestehender Mietwohnungen. Der sogenannte Umwandlungsschutz, der die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschwert, wird verlängert. Damit sollen die Rechte von Mieterinnen und Mietern gestärkt und der Bestand bezahlbarer Wohnungen gesichert werden. Gleichzeitig werden Instrumente aus dem Baulandmobilisierungsgesetz fortgeführt und ausgebaut.
Konkret sieht das Gesetz mehrere Änderungen vor: Kommunen können künftig Bauvorhaben schneller genehmigen, teilweise bereits innerhalb von zwei Monaten. In begründeten Fällen dürfen sie von Vorschriften wie der TA Lärm abweichen. Auch die Befreiungs- und Abweichungsmöglichkeiten nach §§ 31 und 34 BauGB werden erweitert. Außerdem soll eine regelmäßige Evaluation sicherstellen, dass die Sonderregelungen nur so lange gelten, wie sie tatsächlich erforderlich sind.
Allerdings hängt die Wirksamkeit des Bauturbos stark von der Anwendung durch die Kommunen ab. Das Gesetz verpflichtet sie nicht automatisch zur Nutzung der neuen Regelungen – jede Gemeinde muss sich aktiv dafür entscheiden. Darüber hinaus bestehen weitere Herausforderungen: Wenn Rechtsmittelverfahren nicht vereinfacht werden, drohen Einsprachen und Klagen weiterhin Projekte zu verzögern. Auch die hohen Baukosten bleiben ein Hemmnis, weil viele Vorhaben trotz verkürzter Verfahren wirtschaftlich kaum tragfähig sind. Zudem müssen Umweltauswirkungen weiterhin geprüft werden, was in der Praxis Konflikte auslösen kann. Kritiker sehen die Gefahr, dass eine zu starke Lockerung von Planungs- und Beteiligungsverfahren das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Transparenz kommunaler Entscheidungen schwächen könnte.