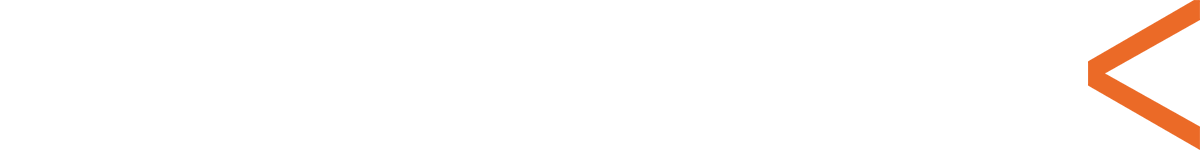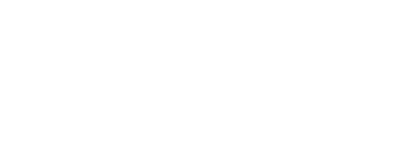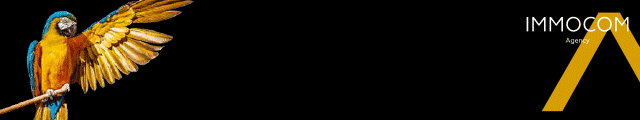Der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg e.V. (AIV) hat in seiner neuesten Ausgabe vom Forum die so genannte Metropolregion unter die Lupe genommen. Die Entwicklungsprognose: dynamisch und eigenständig. Am 30. September findet der SO25 – Der Wirtschafts- und Standortkongress statt, der ebenfalls nur ein Thema kennt: Vom Speckgürtel zum Perspektivraum Brandenburg-Südost-Berlin.
„Städte der Zweiten Reihe – lange Zeit vernachlässigt – rücken nun, bedingt durch die Überlastung der Metropolen, in den Fokus.“ So formuliert es Sebastian Wagner in der aktuellen Ausgabe vom AIV-Forum, der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg e. V. Das AIV-Forum verstand sich als Labor für die Auseinandersetzung mit den großen Fragen von Architektur, Stadtentwicklung und gesellschaftlichem Wandel. Sechs kuratierte Werkstätten bildeten den Rahmen, um diese Themen nicht nur theoretisch zu verhandeln, sondern in einem breiten internationalen und interdisziplinären Austausch zu vertiefen. Jede Werkstatt setzte andere Schwerpunkte und öffnete damit unterschiedliche Zugänge – von sozialen und kulturellen Dimensionen über Fragen der Baupraxis bis hin zu globalen Zukunftsszenarien. Entscheidend war dabei nicht allein die Reflexion, sondern ebenso die praktische Erprobung neuer Ansätze. Indem Theorie und Baukultur mit konkreten räumlichen Fragestellungen in Brandenburg verbunden und zugleich mit internationalen Perspektiven gespiegelt wurden, entstand ein vielschichtiger Resonanzraum. Das Forum machte deutlich, dass eine Internationale Bauausstellung weit mehr sein kann als eine Präsentation von Projekten: Sie wird zum Prozess, der Diskurse bündelt, Erfahrungen sichtbar macht und Impulse für künftiges Handeln gibt.
"Eigenständige politische und räumliche Identität"
„Das Land Brandenburg, eng mit Berlin verbunden, hat dennoch eine eigenständige politische und räumliche Identität. Die darin wiederum liegende Vielfalt begreifen wir als Potenzial fu?r neue Formen des Planens und Bauens“, sagt Geschäftsführer Tobias Nöfer. Klaus Theo Brenner vom Architekturbüro Brenner Krohm und Partner Architekten – bekannt für seine starke Bindung zur Mailänder Moderne – gibt beispielsweise einen detaillierten Einblick in dieser Ausgabe. Nachhaltige Stadtentwicklung beginne mit dem genauen Verständnis der bestehenden Stadt – ihrer Geschichte, ihrer Brüche und ihrer Möglichkeiten. Am Beispiel Rathenow macht er deutlich, dass es nicht um großflächige Expansion geht, sondern um die behutsame Weiterentwicklung des Vorhandenen. Diese „Stadtreparatur“ knüpfe an historische Strukturen an, eröffne zugleich neue Nutzungsmöglichkeiten und aktiviere kulturelle Räume. Ziel ist eine lebendige Innenstadt, die durch Plätze, Straßen, Kinos, Parks, Bildungs- und Kultureinrichtungen Aufenthaltsqualität gewinnt. Erst auf dieser Grundlage lasse sich eine sinnvolle Erweiterung nach außen denken.
Stadt ist bei Klaus Theo Brenner weit mehr als Architektur oder Infrastruktur. Sie ist eine kulturelle Praxis, die sich in gelebter Urbanität ausdrückt: in Begegnungen, in Ereignissen, in der Art und Weise, wie öffentlicher Raum genutzt wird. Die Attraktivität eines Ortes hängt wesentlich davon ab, wie solche Momente gestaltet und ermöglicht werden. Projekte wie die Ausstellung „Welten-Verbinden | Reisen durch Träume und Realitäten“ in Rathenow zeigen, welches Potenzial hier liegt. Sie stiften kulturelle Identität und stärken die Beziehung zwischen Berlin und Brandenburg auf einer unmittelbar erfahrbaren, emotionalen Ebene. Damit solche Impulse Wirkung entfalten, brauche es politische Unterstützung, so der Architekt. Ohne das Bekenntnis zur Qualität städtebaulicher und architektonischer Entwicklung drohen Projekte auf rein ökonomische Ziele reduziert zu werden – und damit ihre kulturelle Bindung zu verlieren. Gerade in Brandenburg zeige sich, welches Potenzial freigesetzt werden kann, wenn gestalterische Qualität, funktionale Vielfalt und kulturelle Programmatik zusammengedacht werden.
Genossenschaften als Labore
Ein zentrales Thema des Forums war die Frage, wie Genossenschaften als Teil einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung gestärkt werden können. Vor dem Hintergrund steigender Mieten, knapper Flächen und einer zunehmenden sozialen Spaltung wurde deutlich, dass diese Organisationsform weit mehr leisten kann, als nur Wohnungen bereitzustellen. Genossenschaften bieten Stabilität, ermöglichen Mitbestimmung und schaffen Räume, die über die reine Wohnnutzung hinausgehen. In den Diskussionen machten Thomas Bestgen, Thilo von Haas, Andreas Rasch, Vite Joksaite, Steffen Adam, Wolfgang Schuster und Sebastian Wagner deutlich, wie breit das Spektrum ist: Es reicht von Konzeptvergaben und einer Bodenpolitik, die das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt, über regionale Energiekreisläufe und Selbstversorgung bis hin zu Architektur als sozialer Infrastruktur – mit offenen Erdgeschossen, gemeinschaftlich nutzbaren Flächen und flexiblen Grundrissen.
Anhand konkreter Beispiele wie dem Lichtenrader Revier und der Alten Mälzerei in Berlin wurde gezeigt, wie Stadtentwicklung durch gemeinschaftliche Planung funktioniert: mit sozialer Mischung, kulturellen Ankerpunkten und einer Architektur, die nicht nur für Bewohner gebaut wird, sondern gemeinsam mit ihnen entsteht. Auch das Modell FairKultur machte deutlich, dass Genossenschaften als Reallabore dienen können – Orte, an denen neue Finanzierungsformen, ökologische Bauweisen und kulturelle Integration erprobt werden. Die Beiträge unterstrichen, dass Genossenschaften kein Randphänomen mehr sind, sondern zunehmend eine tragende Rolle im Gefüge von Staat, Markt und Zivilgesellschaft übernehmen. Sie sichern nicht nur bezahlbaren Wohnraum, sondern wirken auch stabilisierend auf Nachbarschaften, senken Folgekosten für Kommunen und eröffnen neue Möglichkeiten für soziale und ökologische Innovationen.
Wirtschaft 5.0: Regionen als Treiber
Elementar für die Regionen: wirtschaftliche Kraft. Auch dafür lieferte der AIV Beispiele. Im Havelland wird erprobt, wie ländlich geprägte Regionen den Wandel zu einer „Wirtschaft 5.0“ gestalten können. Ausgangspunkt ist Premnitz, wo aus einem klassischen Produktionsstandort ein Reallabor für neue Formen des Bauens und Lebens entsteht. Statt monostruktureller Industrieflächen entstehen Quartiere, die Wohnen, Arbeiten, Kultur und ökologische Infrastruktur verbinden. Besonders betont wurde die Rolle regionaler Strukturen: Kommunen wie Premnitz und Milower Land treiben die Entwicklung aktiv voran, getragen von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, der Genossenschaft RWG und lokalen Partnern. Geplant ist die Gründung einer „Quartierswerk GmbH“, die Energie, Wasser, Mobilität und Digitalisierung bündelt und damit eine neue Form regionaler Daseinsvorsorge schafft.
Neue Technologien wie der 3D-Druck, vorgestellt von Mihai Ichim und Sebastian Wagner, sollen den Bau beschleunigen und ressourcenschonender machen. Ergänzt wird dies durch Konzepte wie die Sektorkopplung, die regionale Energie- und Versorgungsnetze verknüpft und so autarke Strukturen möglich macht. Damit wird deutlich: Der ländliche Raum ist nicht nur Zulieferer der Metropole, sondern kann selbst Impulsgeber sein. Gerade im Havelland zeigen verfügbare Flächen, überschaubare Strukturen und aktive Kommunen, wie regionale Identität zur Grundlage für neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Modelle wird – mit Strahlkraft weit über Brandenburg hinaus.
Vom Speckgürtel zum Perspektivraum Brandenburg-Südost-Berlin boomt
Vom Flughafen BER über TESLA bis zu mittelständischen Industrieperlen – hier entsteht eine der spannendsten Wachstumsregionen Deutschlands. Der kongress SO25 bringt die Entscheider aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung zusammen. Im Fokus: Chancen, Strategien und Netzwerke für eine starke, eigenständige Zukunft der Region. Erleben Sie einen Kongress voller Impulse – mit Top-Speakern, tiefgehenden Panels und konkreten Projekten zu Fachkräftesicherung, Infrastruktur, Innovation und Immobilien: am 30. September 2025.