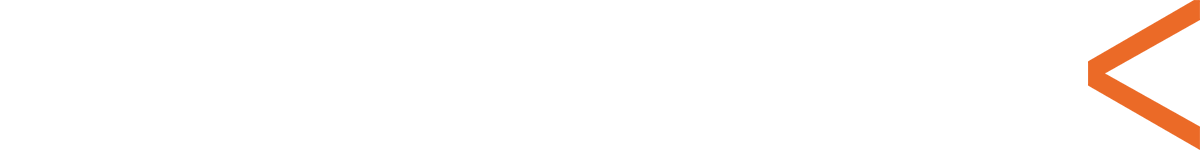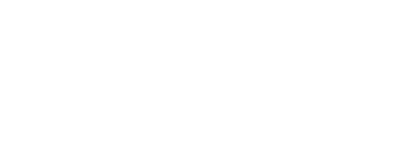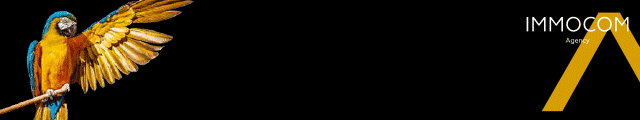Zukunftsforscher Matthias Horx sprach beim SO26 Der Wirtschafts- und Standortkongress über neue Narrative von Heimat und regionalem Wachstum.
Zukunft ist für Matthias Horx kein Ziel, sondern ein Zustand in Bewegung. „Zukunft braucht Dynamik“, sagt der Gründer der The Future:Project AG. „Wir müssen lernen, in Prozessen zu denken, nicht in Prognosen.“ Sein Ansatz sei keine Prophetik und keine Kaffeesatzleserei. „Aber man kann Systeme verstehen und daraus Handlungen ableiten.“
Matthias Horx beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. Mit einem interdisziplinären Team hat er zuletzt sogar einen „Friedhof der Zukunft“ entworfen – ein Projekt, das mit rund acht Millionen Euro realisiert wurde. Der Ansatz hier: die zunehmende Verwahrlosung und Vernachlässigung historischer Friedhöfe. Für ihn sind solche Orte Ausdruck einer tieferen Frage: Wie gehen wir mit dem Vergangenen um, während wir uns in die Zukunft bewegen? „Zukunft entsteht nicht im luftleeren Raum“, sagt Matthias Horx. „Wir müssen lernen, aus den Prozessen der Vergangenheit wieder zurückzufinden.“
„Wir leben in einer Omnikrise“
Der Zukunftsforscher sieht die Gegenwart als Übergangsphase, als „Omnikrise“. „Verschiedene Krisen verstärken sich gegenseitig – wirtschaftliche, soziale, kulturelle. Das ist historisch vorauszusehen, in Abständen von 50 bis 70 Jahren.“ Er spricht vom „Comeback der Kriege“, von der demografischen Krise – die Menschheit schrumpft, nachdem sie jahrzehntelang gewachsen ist – und von einer kognitiven Krise, ausgelöst durch das Internet. „Wir leben in einer Erregungskultur. Unterstellungen, Vermutungen, Ängste bestimmen das Gespräch. Künstliche Intelligenz zwingt uns, neu zu definieren, was eigentlich menschliche Intelligenz ist.“ Trotz allem bleibt er optimistisch. „Krisen sind keine Katastrophen, sondern Wandlungen. Wir erleben das Ende der Linearität, und das ist gut so. Denn jeder lineare Fortschritt war irgendwann eine Sackgasse.“
„Jeder Trend erzeugt seinen Gegentrend“
Über viele Jahre arbeitete Matthias Horx mit dem Modell der Megatrends, zu denen Globalisierung, Urbanisierung, Nachhaltigkeit beispielsweise zählen. Heute betrachtet er diese Denkweise als überholt. „Die Matrix funktioniert nicht mehr. Jeder Trend erzeugt gleichzeitig einen Gegentrend. Das ist irritierend, aber auch beruhigend.“
Auf die Globalisierung folge die Reindustrialisierung, auf die Digitalisierung der aktive Widerstand – etwa in Form des De-Influencing –, auf die Individualisierung der Mut zum Mittelmaß und auf die Urbanisierung die progressive Provinz. „Wir versuchen ständig, das, was früher funktioniert hat, noch intensiver zu tun. Das erschöpft uns, weil es nicht mehr funktioniert. Durch den Gegentrend entsteht eine Blockade, aber auch eine Chance, neu zu denken.“
„Global wird lokal – das ist Glokalisierung“
Diese Neuorientierung bedeute nicht Rückzug, sondern Transformation. „Die Auflösung der Globalisierung führt zur Glokalisierung“, erklärt Matthias Horx. „Global und lokal wachsen wieder zusammen. Regionen gewinnen Autonomie, ohne dass der weltweite Austausch verloren geht.“
Ein zentraler Ausdruck dieser Entwicklung sei die Rur:banisierung – die Vermischung von Stadt und Land. „Städtische Lebensformen tauchen im ländlichen Raum auf und verändern das Leben dort. Gleichzeitig wächst in der Stadt das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Überschaubarkeit, nach den Qualitäten des Dorfes. Wir drehen eine Schleife – was als Stadtflucht begann, wird sich wieder umkehren.“ Die Zufriedenheit mit der Lebensqualität sinke in den Metropolen, nicht aber in den kleinen und mittleren Städten. „Das ist die Chance der progressiven Provinz“, sagt Matthias Horx. „Dort, wo Ideen und Gemeinschaft entstehen, wächst Zukunft. Geldmangel ist selten das Problem, Ideenmangel schon.“
Matthias Horx plädiert für eine neue Mischung: Industrie, Handel und Handwerk sollten nicht mehr als getrennte Welten betrachtet werden. „Wir brauchen hybride Strukturen – wie in Vorarlberg oder im Kreativpark Lokhalle in Freiburg. Vielfalt ist die neue Stärke.“ Entscheidend sei eine Zivilgesellschaft mit Willen und Selbstvertrauen. „Zukunft entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen. Wo Verwaltungen mutig handeln, wo Projekte Ecken und Kanten haben und wo man sich traut, auch mal zu scheitern.“ Er spricht von einer neuen politischen Kultur jenseits ideologischer Lager. „Wir leben im transideologischen Zeitalter. Bürgermeister haben heute den größten Erfolg, wenn sie parteilos sind. Sie praktizieren systemische Zuneigungspolitik, also Nähe zu den Bürgern, nicht zu Parteiprogrammen.“
„Selbstvertrauen und Jammerverzicht“
Was macht also eine zukunftsfähige Region aus? Für Matthias Horx sind es keine Masterpläne, sondern Haltungen: Vertrauen in die eigenen Stärken, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und der Mut, Querköpfe einzubinden. „Regionen brauchen aktive Heimkehrer, kreative Verwaltungen, lokale Visionäre und eine Portion Selbstironie. Leichtigkeit ist ein unterschätzter Faktor. Wenn man zu verkrampft an die Zukunft herangeht, wird sie schwer.“ Besonders wichtig sei die innere Haltung. „Selbstvertrauen und Jammerverzicht – letzteres ist extrem schwierig. Versuchen Sie das mal privat, einen Tag lang nicht zu jammern. Es verändert die Wahrnehmung sofort.“
Matthias Horx fasst zusammen: „Wir brauchen Mutanfälle statt Wutanfälle.“ Zukunft, sagt er, entstehe nicht durch Angst, sondern durch Neugier. Und vielleicht, fügt er hinzu, „bauen wir gar keinen Friedhof der Zukunft, sondern ein neues Dorf der Möglichkeiten.“