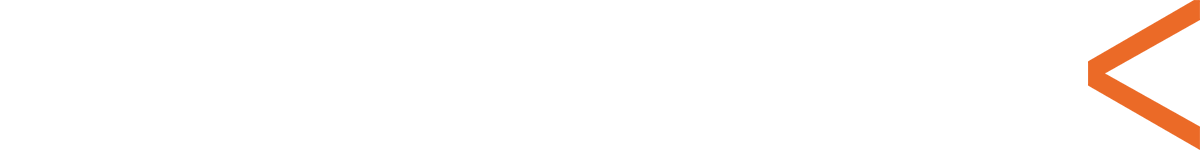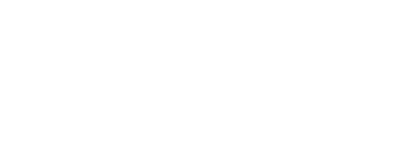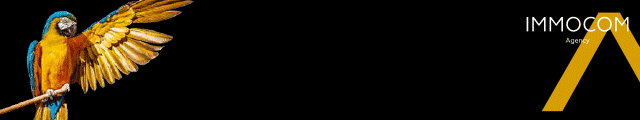Wie lassen sich Quartiere so planen, dass sie Klimarisiken standhalten, soziale Stabilität sichern und zugleich wirtschaftlich tragfähig bleiben? Diese Frage stand im Zentrum des vierten Kongresses für Innovative Quartiersentwicklung am EBZ in Bochum. Vertreter aus Politik, Kommunen, Wissenschaft und Immobilienwirtschaft diskutierten konkrete Ansätze für resiliente, sozial integrierte und klimagerechte Stadtstrukturen. Im Fokus stand dabei das Zusammenspiel von Immobilienwirtschaft, Kommunen und Wissenschaft als strategisches Kräftedreieck urbaner Transformation.
Resonanz spiegelte Relevanz: Mehr als 350 Fachleute aus Politik, Kommunen, Wissenschaft und Immobilienwirtschaft – so viele wie nie – folgten der Einladung des Deutschen Instituts für Urbane Transformation (DIUT) in Kooperation mit der EBZ Business School (FH) zum vierten Kongress für Innovative Quartiersentwicklung. Das Programm rezipierte ökologische, soziale, politische und ökonomische Anforderungen und drehte sich um das Kräftedreieck aus Immobilienwirtschaft, Kommunen und Wissenschaft als Treiber von Quartiersentwicklung im Rahmen urbaner Transformation.
Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, erinnerte daran, dass es bei Quartiersentwicklung gegenwärtig nicht nur um Klimaschutz, um alten-, behinderten- und familiengerechtes Wohnen oder Mobilität gehen dürfe. Beachtung gelte zum Beispiel auch dem Problem der Schrumpfung: Seit der Gebietsreform 1974 hätten viele Städte in NRW bis zu 40 Prozent ihrer Bevölkerung verloren – ohne dass die Infrastrukturen kostensparend mitgeschrumpft seien. Auch Fragen der Kriminalitätsprävention seien zu diskutieren, da sich in der Bevölkerung ein Gefühl der Unsicherheit ausbreite, das ernst genommen werden müsse. Ihr Appell ins Plenum galt daher einem „Quartiersentwicklungskommando“, das zu bilden sei, um sich den großen Aufgaben zu stellen.
Eine Keynote gab Ola Gustafsson vom schwedischen Unternehmen Think Softer. Am Beispiel gewachsener Quartiere in Venedig und aus 197070er-Jahre-Bauten umgestalteter Quartiere in Malmö zeigte er, wie lebenswerte Orte neu geschaffen werden können – Orte, die zu Begegnung einladen und eine hohe Lebensqualität aufweisen. Er führte das Leitbild von Soft Cities vor Augen: Hier stehen nicht dichte Bebauung und Effizienz im Vordergrund, sondern soziale Beziehungen, eine vielfältige Nutzungsstruktur und eine hohe Aufenthaltsqualität.
Es gab insgesamt sechs Sessions. Ein zentraler Themenblock war die klimaresiliente Stadt, insbesondere durch blau-grüne Infrastrukturen, nachhaltige Freiraumgestaltung und praxisnahe Strategien zur Anpassung an Extremwetterereignisse. Ergänzt wurde dies durch Diskussionen zur sozialen Resilienz, mit Fokus auf Teilhabe, Engagement, Kultur und neue Formen des Miteinanders. Diskussionsstoff ergab sich dabei aus der Frage, welches Maß an blau-grünen Infrastrukturen mit Automobilität vereinbar sei.
Weitere Schwerpunkte lagen auf der Gestaltung von Zukunftsquartieren, innovativen Wohn- und Nachbarschaftsmodellen sowie der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren. Auch Zirkularität und Urban Mining spielten eine wichtige Rolle mit Blick auf ressourcenschonendes Bauen, Materialkreisläufe und den Umgang mit dem Gebäudebestand. Dabei entbrannte eine heftige Diskussion darüber, ob entsprechende Vorgaben verbindlich vorgeschrieben werden sollten – und wer die Mehrkosten tragen würde. Denn deutlich wurde auch, dass diese Mehrkosten den ohnehin auf Kante genähten Kostenrahmen sprengen würden.
Zukunftsquartiere, Zirkularität und neue Mobilität
Abgerundet wurde das Programm durch Beiträge zu nachhaltigen Mobilitätskonzepten, zur Neuverteilung und Nutzung des öffentlichen Raums sowie zu Resilienzstrategien für kritische Infrastrukturen einschließlich Energieversorgung und digitaler Sicherheit. Internationale Perspektiven und übergeordnete Leitbilder einer „weichen“, menschenorientierten Stadtentwicklung gaben dem Kongress einen strategischen Rahmen.
Den Abschluss bildete ein Vortrag von Klaus Grewe, Gesamtkoordinator für die Infrastrukturprojekte der Olympischen Spiele in London 2012. Anlässlich der geplanten Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region um die Ausrichtung der Spiele 2026, 2040 oder 2044 stellte er die Frage, wie Sportgroßprojekte Städte in Bewegung bringen – und was bleibt. Ernüchternd war, dass – wie die Spiele der 2000er-Jahre zeigten – eher wenig übrig geblieben ist. Denn am Ende würdige das IOC Nachhaltigkeitsansätze bei Bewerbungen eher selten.