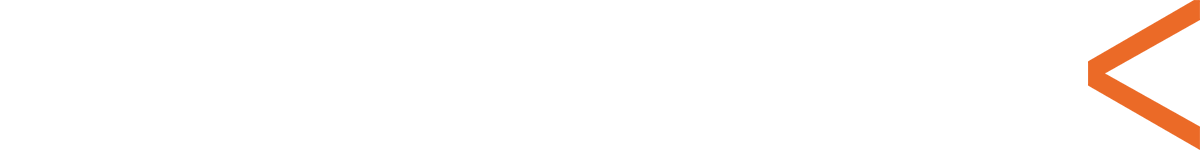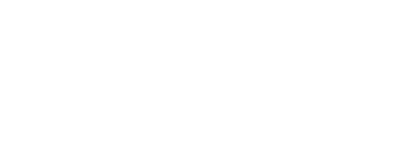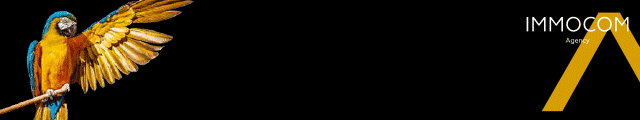Das Einfamilienhaus bleibt für viele Haushalte attraktiv, zugleich rücken in den jüngsten Studien die Kosten, der Flächenverbrauch und der Umgang mit dem Bestand deutlich stärker in den Fokus. IMMOBILIEN AKTUELL hat sich verschiedene Aspekte angeschaut.
Die Studie „Das Einfamilienhaus – ein Auslaufmodell mit Zukunft“ des vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. plädiert für eine sachliche Neubewertung des Einfamilienhauses jenseits pauschaler Kritik und ordnet die Wohnform differenziert in aktuelle wohnungs-, sozial- und klimapolitische Debatten ein. Ausgangspunkt ist die hohe strukturelle Bedeutung des Segments: In Deutschland existieren rund 13 Millionen Einfamilienhäuser, jährlich entstehen seit Jahren stabil etwa 80.000 neue Einheiten. Setzt sich dieser Trend fort, kommen bis 2040 weitere rund 1,2 Millionen hinzu. Von einem Auslaufmodell im quantitativen Sinne kann daher keine Rede sein, vielmehr handelt es sich um eine weiterhin stark nachgefragte Wohnform mit erheblichem Einfluss auf Wohnungsmarkt, Vermögensbildung und Siedlungsentwicklung.
Zentraler Befund der Autoren ist, dass das Einfamilienhaus nach wie vor ein breites Wohnideal darstellt, das längst nicht mehr ausschließlich auf klassische Familienhaushalte begrenzt ist. Empirische Untersuchungen zeigen, dass auch kinderlose Paare, ältere Haushalte und Menschen in postfamiliären Lebensphasen gezielt Einfamilienhäuser nachfragen. Die Entscheidung für diese Wohnform ist dabei nicht Ausdruck unreflektierter Tradition, sondern Ergebnis bewusster Abwägungen zwischen Wohnbedürfnissen, Lebensentwürfen und finanziellen Rahmenbedingungen. Die Nachfrage gilt damit als strukturell stabil und keineswegs gesättigt.
Deutschland mit niedriger Eigentumsquote
Ein weiterer zentraler Argumentationsstrang betrifft die Rolle des Einfamilienhauses für Vermögensbildung und Altersvorsorge. Deutschland weist im internationalen Vergleich eine niedrige Wohneigentumsquote auf, was sich nach Einschätzung der Autoren negativ auf die Vermögensverteilung und die private Altersabsicherung auswirkt. Besonders problematisch ist die geringe Eigentumsbildung jüngerer Generationen, da sie langfristig Vermögensungleichheit verstärkt. Vor diesem Hintergrund kritisiert die Studie eine Wohnungspolitik, die Selbstnutzer über Jahre hinweg weniger stark gefördert hat als Mietinvestoren, und fordert eine stärkere Gleichbehandlung.
Auch wohnungspolitisch messen die Autoren dem Einfamilienhaus eine relevante Funktion bei. Entgegen verbreiteter Skepsis gegenüber sogenannten Sickereffekten belegt die empirische Forschung, dass gerade der Neubau von Einfamilienhäusern überdurchschnittlich lange Umzugsketten auslöst und damit zur Entlastung angespannter Wohnungsmärkte beitragen kann. Zwar wirken diese Effekte in angespannten Märkten zunächst schwächer, langfristig tragen zusätzliche Neubauaktivitäten jedoch selbst zur Marktentspannung bei. Hinzu kommt eine vergleichsweise hohe private Zahlungsbereitschaft, die den Neubau auch bei begrenzten öffentlichen Fördermitteln ermöglicht.
In der Klimadebatte wendet sich die Studie gegen eine pauschale Verurteilung des Einfamilienhauses. Die Autoren zeigen, dass Unterschiede in der CO2-Bilanz gegenüber dem Geschosswohnungsbau vor allem auf größere Wohnflächen zurückzuführen sind, nicht auf den Gebäudetyp an sich. Entscheidend für Emissionen sind Bauvolumen, energetische Qualität, technische Ausstattung und Energiequellen. Wird eine ähnlich große Wohnung im Mehrfamilienhaus bewohnt, relativieren sich die Unterschiede deutlich. Der höhere Emissionsausstoß einkommensstarker Haushalte sei zudem ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das nicht allein über Restriktionen einzelner Wohnformen adressiert werden könne. Stattdessen plädiert der vhw für systemische Ansätze zur Emissionsminderung, etwa über das erweiterte europäische Emissionshandelssystem.
Deutlich kritischer fällt die Bewertung der Siedlungsentwicklung aus. Problematisch sei weniger das Einfamilienhaus selbst als vielmehr seine häufige Realisierung in flächenintensiven, schlecht angebundenen Strukturen. Zwischen freistehender Villa auf großem Grundstück und kompaktem Stadthaus bestehen erhebliche Unterschiede in Flächenverbrauch, Infrastrukturkosten und Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Studie fordert daher eine stärkere Innenentwicklung, eine bessere regionale Steuerung der Flächennutzung und die gezielte Integration kompakter Einfamilienhäuser in urbane Kontexte.
Besondere Aufmerksamkeit widmet die Analyse den Potenzialen im Bestand. Rund ein Viertel der Einfamilienhäuser wird von Haushalten ab fünfundsechzig Jahren bewohnt, häufig auf Wohnflächen, die nicht mehr vollständig genutzt werden. Hier sehen die Autoren erhebliche Reserven, etwa durch Umzüge in barrierefreie Wohnungen, durch Teilung, Umbau oder ergänzende Vermietung. Voraussetzung dafür sind jedoch attraktive Wohnalternativen im unmittelbaren Umfeld sowie flexiblere planungs- und bauordnungsrechtliche Rahmenbedingungen, die Umbauten erleichtern und Kosten senken.
Kompaktes Stadthaus als zukunftsfähiger Typus?
Für den Neubau skizziert die Studie das kompakte Stadthaus als zukunftsfähigen Typus. Ziel ist es, bestehende Nachfrage wieder stärker in urbanen Lagen zu binden und Abwanderung an den Stadtrand zu reduzieren. Gefordert werden schnellere und flexiblere Planungsverfahren, hohe städtebauliche Qualität, klimaangepasste Freiraumkonzepte sowie eine soziale und technische Infrastruktur, die auch bei höherer Dichte Lebensqualität ermöglicht. Das Einfamilienhaus wird dabei nicht als Gegenmodell zur Stadt verstanden, sondern als integrierbarer Bestandteil einer zeitgemäßen, differenzierten Stadtentwicklung.
Das Einfamilienhaus gilt in vielen Analysen nach wie vor als beliebteste Wohnform in Deutschland: Auch in der BPD?Auswertung „Einfamilienhäuser im Wandel: Warum nicht etwas kleiner?“ wird diese Rolle ausdrücklich hervorgehoben. Zugleich setzen Dinge wie steigende Baukosten, höhere Zinsen und strengere Nachhaltigkeitsanforderungen den klassischen Traum vom großen Eigenheim deutlich unter Druck. BPD versucht diesen Spannungsbogen in ihrer Kurzstudie „Die Zukunft des Einfamilienhauses ist kompakt“ zu vermessen. Dort heißt es, die Zukunft des Einfamilienhauses liege in einer kompakteren Bauweise mit reduzierter Wohnfläche, weil jeder eingesparte Quadratmeter sowohl die Herstellungskosten als auch den ökologischen Fußabdruck senke und damit auf Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit einzahle. Laut der Studie präferieren rund 58 Prozent der Haushalte, die den Kauf eines Einfamilienhauses planen, Wohnflächen von weniger als 120 Quadratmetern; bei Haushalten mit Mietabsicht liegt dieser Anteil bei 79 Prozent. Für 36 Prozent der Kauf? und 61 Prozent der Mietinteressenten kommen nach BPD sogar Häuser mit 80 bis 99 Quadratmetern in Betracht. Das ist eine Größenordnung, die das klassische Bild vom großzügigen Einfamilienhaus relativiert.
„Unsichtbare Wohnraumreserven“
Während BPD den kompakten Neubau in den Mittelpunkt stellt, richten andere Studien den Blick stärker auf den vorhandenen Bestand. Der Beitrag „Der unsichtbare Leerstand im Einfamilienhaus“ (KOMMUNAL 2024/2025) weist darauf hin, dass in Deutschland ein großer Teil der Einfamilienhäuser von ein oder zwei Personen bewohnt wird, obwohl sie ursprünglich für Familien mit mehreren Kindern gebaut wurden. „Unsichtbare Wohnraumreserven“ wird es dort genannt. Gemeint sind damit neue Baugebiete, die trotz stagnierender Einwohnerzahlen initiiert werden, obwohl in bestehenden Einfamilienhausgebieten erhebliche Unterbelegung vorliege.
Die raumplanerische Forschung knüpft daran an: In Arbeiten zur Transformation von Einfamilienhausgebieten wird untersucht, wie sich diese Siedlungen über Umbau, Teilung oder ergänzende Bebauung weiterentwickeln lassen. Diskutiert werden etwa Einliegerwohnungen, das Aufteilen großer Häuser in mehrere Einheiten oder punktuelle Nachverdichtungen, um mehr Bewohner auf der gleichen Fläche unterzubringen und gleichzeitig neuen Wohnraum zu schaffen. Auch der Ressourcen? und Energieaspekt spielt immer wieder eine Rolle. Das Impulspapier „Klimafreundlicher Umbau des Einfamilienhausbestandes“ vom Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz (AKK) verweist auf die im Vergleich zu Geschosswohnungsbauten größeren Hüllflächen und die hohe Wohnfläche pro Kopf in vielen Ein? und Zweifamilienhäusern. In Kombination mit dem dena?Gebäudereport 2024, der Ein? und Zweifamilienhäuser als flächenmäßig dominierendes Segment beschreibt, ergibt sich ein Bild, in dem energetische Sanierung und Flächeneffizienz zentrale Stellschrauben für die Erreichung der Klimaziele im Gebäudebereich sind.
Interessant ist, wie sich die Perspektiven ergänzen: BPD und auch der IW?Kurzbericht „Kompakte Einfamilienhäuser als Antwort auf veränderte Rahmenbedingungen am deutschen Immobilienmarkt“ betonen die hohe Nachfrage nach dem Haustyp, schlagen aber kleinere Gebäude als Reaktion auf veränderte Zinsen, Preise und Haushaltsstrukturen vor. Kommunale Beiträge wie „Der unsichtbare Leerstand im Einfamilienhaus“ und Studien zum Bestandsumbau rücken dagegen stärker die Frage in den Vordergrund, wie der vorhandene Einfamilienhausbestand besser genutzt und an den demografischen Wandel angepasst werden kann.