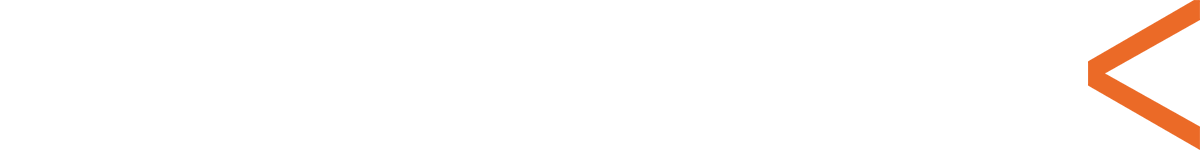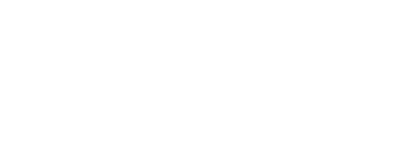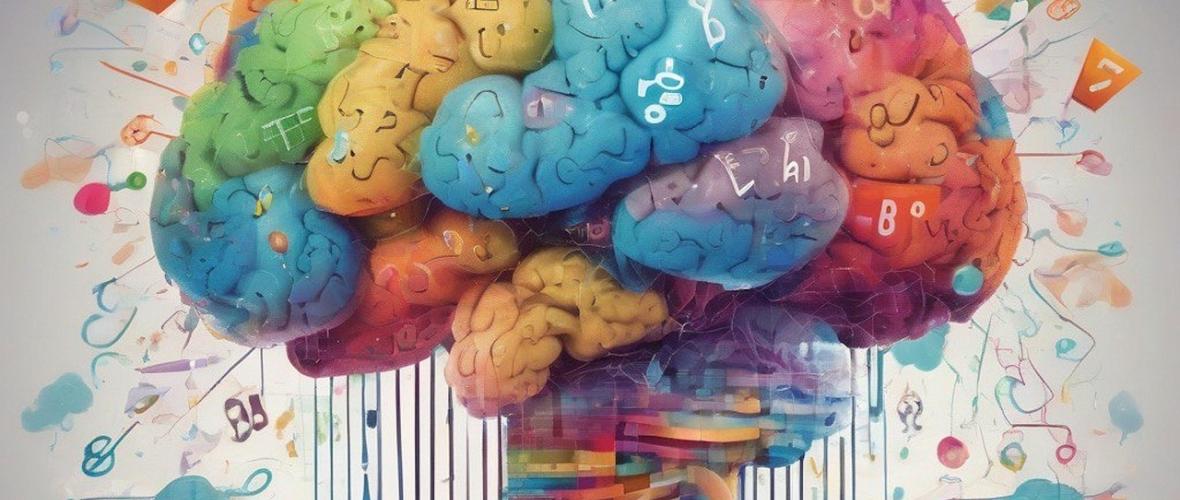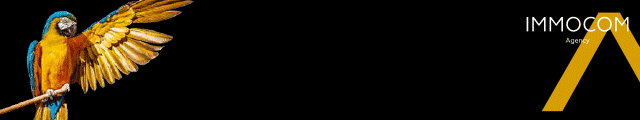Die pom+ Consulting AG hat 55 KI-Lösungen untersucht und 24 marktrelevante Anwendungsfälle identifiziert. Das Whitepaper zeigt: Während sich im Betrieb zahlreiche Anwendungen etablieren, bleibt die Planungsphase deutlich zurück. Investorinnen und Bestandshalter profitieren am meisten – Nutzer und Mieter hingegen kaum. Ein Meinungskommentar.
Alle reden über Künstliche Intelligenz. Über ChatGPT, über smarte Prozesse, über den digitalen Quantensprung. Und doch zeigt sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ein Bild, das ernüchternder kaum sein könnte: Nur jedes sechste Unternehmen nutzt aktuell AI. Gleichzeitig sehen drei Viertel der Fachkräfte ein hohes oder sehr hohes Potenzial. Die Diskrepanz zwischen Einsicht und Umsetzung ist frappierend – und erinnert fatal an den berüchtigten „Bauturbo“: lautstark angekündigt, aber in der Realität kaum spürbar.
Dabei liegt das Spielfeld klar vor uns. Die Studie von pom+ identifiziert 24 konkrete Anwendungsfälle für AI entlang des gesamten Immobilienlebenszyklus. Von der automatisierten Baufortschrittskontrolle mit Drohnen über die Erstellung von 3D-Modellen bis zur Optimierung von Heizungsanlagen und der Entwicklung von Dekarbonisierungsstrategien: Das Potenzial ist greifbar, praxisnah, längst erprobt. Besonders in der Betriebsphase, wo Datenmengen groß sind und laufende Kosten entstehen, könnten Betreiber und Eigentümer durch AI signifikant profitieren. Die Automatisierung von Reinigungsplänen, die intelligente Steuerung technischer Anlagen oder die Analyse von Verbrauchsdaten – all das sind Low-Hanging-Fruits, die unmittelbar Effizienz und Nachhaltigkeit bringen würden.
Und doch bleibt die Branche im Stadium der schönen Worte stecken. Laut pom+ verschwinden viele Lösungen so schnell, wie sie auf den Markt kommen. Prototypen, Marketingprodukte, Versprechen. Wenige Systeme schaffen den Sprung in die Praxis. Was fehlt, ist die Bereitschaft, ernsthaft in Datenqualität, Infrastruktur und vor allem in die Kultur zu investieren. Die Branche leidet an einem strukturellen Digitalisierungsdefizit: fragmentierte Daten, fehlende Verantwortlichkeiten, ein IT-Setup von gestern. Ohne diese Basis bleibt AI ein theoretischer Baukasten, der weder Kosten spart noch Innovation ermöglicht.
Das Problem ist weniger die Technologie als der Wille, sie zu implementieren. Eigentümer und Investoren, die am stärksten von AI profitieren könnten, reden über Chancen, aber scheuen die Konsequenz. Pilotprojekte bleiben Insellösungen, Ergebnisse werden nicht skaliert, interne Widerstände blockieren Veränderung. So wird der Rückstand größer – während andere Branchen längst Standards setzen.
Die Branche hat schlicht keine Ausrede mehr. Steigende Bau- und Betriebskosten, wachsende Regulierungsauflagen und das drängende Thema Nachhaltigkeit machen AI zur Pflicht, nicht zur Kür. Wer heute weiter abwartet, zahlt morgen doppelt – mit ineffizienten Prozessen, steigenden Betriebskosten und einem Wettbewerbsnachteil, der sich nicht mehr aufholen lässt. Während in anderen Industrien AI längst Standard ist, verharrt die Immobilienwirtschaft in Pilotprojekten und Absichtserklärungen. Das ist nicht Vorsicht, das ist Stillstand.
Die Studie zieht ein Fazit, das kaum deutlicher sein könnte: AI ist bereit, die Immobilienwirtschaft aber nicht. Anwendungsfälle gibt es genug. Es fehlt an Ernsthaftigkeit, Priorisierung und Mut. Wer weiter abwartet, bleibt zurück – und riskiert, dass aus der digitalen Aufholjagd ein nie endendes Hinterherlaufen wird.