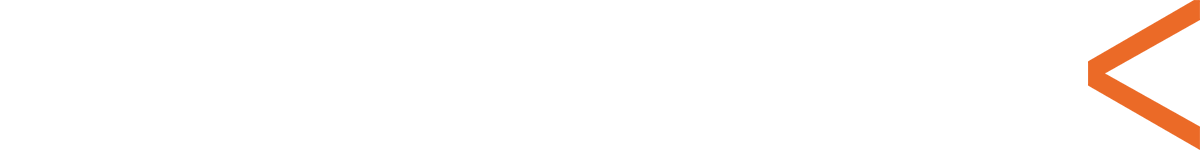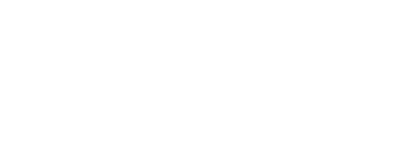Der Bausektor hat wesentlichen Einfluss auf den Klimawandel, denn rund 40 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland sind gebäudebezogen. Neubauten verursachen dabei nicht nur während des Betriebs CO2, sondern bereits durch Materialherstellung und Bauprozesse. Genau hier setzt das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) an. Energieberaterin Verena Sommerfeld analysiert für IMMOBILIEN AKTUELL.
Kernstück ist die Lebenszyklusanalyse (LCA), bei der alle Phasen eines Gebäudes – von der Rohstoffgewinnung über die Nutzung bis zum Rückbau – betrachtet werden. So lassen sich Entscheidungsvarianten auf ihren gesamten Ressourcen- und Emissionsaufwand prüfen, um Baustoffe und Konstruktionen möglichst klimafreundlich auszuwählen.
Warum ganzheitlich denken?
Bisher regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor allem den Energiebedarf im Betrieb: Fossile Brennstoffe sollen weichen, Wärme soll überwiegend aus erneuerbaren Energien stammen. Doch Materialherstellung und Entsorgung verursachen ebenfalls beträchtliche Emissionen. Ökobilanzierung (LCA) fokussiert daher auf den gesamten Lebenszyklus: Wo kommt ein Baustoff her? Wie viel Energie steckt in seiner Produktion? Welche Emissionen entstehen beim Transport, der Montage oder beim Rückbau?
Klimafreundliches Bauen: Standard und Fördermittel
Ein Neubau gilt als „klimafreundliches Wohngebäude“ (KFWG), wenn er bestimmte Mindestkriterien erfüllt: die Anforderungen an das Treibhauspotential (GWP100) und das Effizienzhaus-40-Niveau müssen erreicht werden und die Wärmeerzeugung auf Basis fossiler Energie (Öl und Gas) oder Biomasse sind ausgeschlossen. Wer weitere Anforderungen erfüllt, kann zusätzlich die Nachhaltigkeitszertifizierung QNG (PLUS oder PREMIUM) anstreben. Vergabestellen für das Zertifikat, die vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) akkreditiert sind, prüfen hier unter anderem, ob während der gesamten Bau- und Nutzungsphase möglichst wenig CO? und Primärenergie verbraucht wird. Erreicht das Gebäude dieses Niveau, winken für den Bauherrn oder Erwerber zinsvergünstigte Kredite und Tilgungszuschüsse über die KfW-Programme (KFN, Klimafreundlicher Neubau). So entsteht ein handfester Anreiz, Gebäude nachhaltiger zu planen.
Lebenszyklusanalyse (LCA): Praxistauglichkeit und Nutzen
Eine LCA deckt die Umweltwirkungen unterschiedlichster Bauweisen und Materialien auf. Dazu zählt der Energiebedarf beim Herstellen des Betons oder der Dämmstoffe genauso wie die Emissionen aus Transport und Rückbau. Wer Neubauvarianten anhand solcher Zahlen vergleicht, kann teure Fehlentscheidungen vermeiden und früh gegensteuern. Bei konventionellen Bauweisen entsteht oft ein hoher „grauer Energieanteil“, was den CO?-Fußabdruck steigert. Eine nachhaltige Konstruktion mit möglichst schadstofffreien oder wiederverwertbaren Baustoffen schont dagegen Ressourcen und erleichtert Recycling.
Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)
Das QNG bündelt diese Aspekte. Bewertet werden unter anderem ökologische Fragen wie Schadstoffvermeidung und Ressourcenschutz, aber auch soziokulturelle Faktoren wie altersgerechte Nutzung und gesunde Innenraumluft. Für die Baupraxis heißt das: Planer müssen Konstruktion, Betrieb, Instandhaltung und potenzielle Rückbauszenarien einbeziehen. Nur wenn sich Materialkreisläufe schließen, etwa durch recyclingfähige Komponenten, sinkt der Gesamt-CO?-Ausstoß.
Nachhaltige Baustoffwahl
Holz zählt zu den häufig erwähnten Lösungen. Es kann, sofern aus zertifizierter Forstwirtschaft stammend, als nachwachsender Rohstoff überzeugen. Andere Naturstoffe wie Lehm oder Schafwolle bieten ähnlich günstige Lebenszyklusbilanzen, wenn sie regional verfügbar sind. Auch Beton lässt sich verbessern, etwa durch Recyclingbeton oder Zementersatzstoffe, um den CO?-Ausstoß zu verringern. Hinsichtlich Schadstoffvermeidung lohnt sich ein Blick auf Portale wie wecobis.de, die Informationen zu bauökologischen Aspekten bieten.
Gebäudehülle und Haustechnik im Fokus
Der Betrieb eines Hauses verursacht über die Jahre hinweg hohe Energieverbräuche. Deshalb ist eine optimale Gebäudehülle essenziell, damit möglichst wenig Heiz- oder Kühlenergie verloren geht. Mithilfe einer LCA kann man verschiedene Dämmstoffe vergleichen, auch unter dem Gesichtspunkt der Wiederverwendbarkeit. Zudem sind effiziente Heiz- und Lüftungssysteme, die auf erneuerbare Energien setzen, ein zentraler Baustein für eine positive Ökobilanz. Wichtig bleibt, dass man nicht nur die Betriebsenergie, sondern auch die Materialherstellung im Blick behält.
Barrierefreiheit und soziokulturelle Qualität
Das QNG bewertet zusätzlich Faktoren wie altengerechte Gestaltung: Nur ein bis zwei Prozent des heutigen Wohnbestands ist barrierearm. Für einen Neubau sollte man also von Beginn an planen, ob er leicht umgebaut werden kann, etwa indem man breitere Türen und schwellenarme Zugänge vorsieht. Auch solche Aspekte fließen in die Zertifizierung ein und machen Gebäude zukunftsfähig.
Wirtschaftlicher Nutzen
Der Einsatz nachhaltiger Baustoffe erscheint im Erstinvest erst einmal teurer. Über die Gesamtlebensdauer betrachtet, spart er jedoch Energie und CO?-bedingte Betriebskosten. Auch in Bezug auf den Immobilienwert zeigt sich: Zertifizierte Neubauten lassen sich besser vermarkten, da Energieeffizienz und ökologische Kriterien im Kaufentscheid immer wichtiger werden. Zusätzlich bietet das QNG-Zertifikat Zugang zu höheren Förderungen von der KfW-Bank .
Ausblick
Mit dem QNG wächst die Bedeutung der ganzheitlichen Bilanzierung bei Neubauten. Gesetzliche Regularien wie die EPBD (Europäische Gebäuderichtlinie), die schrittweise in den Mitgliedstaaten Lebenszyklusanalysen vorschreibt, und das Bestreben, CO?-Emissionen weiter zu senken, machen es unumgänglich, dass dieser Ansatz Standard wird. Bauherren, die sich jetzt mit LCA beschäftigen und konsequent nachhaltige Projekte planen, sichern sich einen Vorsprung. Denn klimafreundliche Gebäude schonen nicht nur Umwelt und Gesundheit, sondern bieten auch ökonomische Vorteile, etwa bei Energie- und Betriebskosten.
Verena Sommerfeld ist Bauingenieurin mit über 26 Jahren Erfahrung und Inhaberin von Sommerfeld Energieberatung, spezialisiert auf energieeffizientes Bauen, Sanierungen und Fördermittel. Sie verfügt über umfassende Zusatzqualifikationen als Energieberaterin für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie in der LCA-Bilanzierung für nachhaltige Bauprojekte. Mit speziellem Fachwissen im Denkmalschutz unterstützt sie die energetische Modernisierung historischer Gebäude, ohne deren Charakter zu beeinträchtigen.