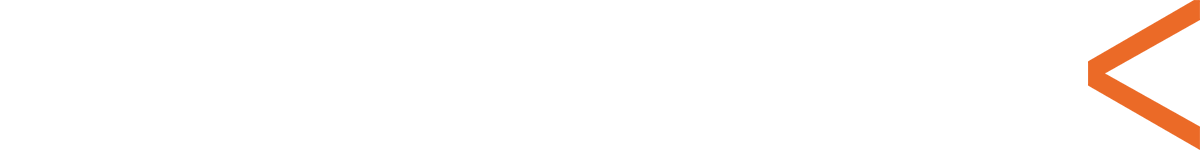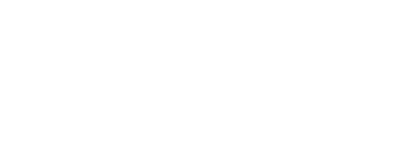Die deutsche Bau- und Immobilienbranche ist im Umbruch. Hinter ihr liegen Jahre schmerzhafter Umwälzungen, geprägt von Unsicherheit, Stagnation und dem Verfehlen eigener Ziele. Nicht zuletzt deshalb lasten große Hoffnungen auf der neuen Regierung und unserer neuen Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Verena Hubertz. Welche Chancen jetzt ergriffen werden müssen und wie endlich der Turnaround gelingt, erläutert Michael Voss. Als Veranstalter des Deutschen Baupreises und Geschäftsführer des Bauverlages ist er so nah am Markt wie kaum ein anderer. Er ist sicher: Mit dem richtigen Mix aus Tempo, Technologie und klugen Reformen kann Deutschland wieder zu alter Stärke zurückfinden.
Die Herausforderungen der Branche zu benennen, ist wie Eulen nach Athen zu tragen und eigentlich hinreichend bekannt: Wohnungsnot, steigende Baukosten,Fachkräftemangel, bürokratische Hürden – all diese Faktoren bremsen seit Jahren die Branche und lähmen einen der wichtigsten Märkte der Republik. Allerdings ist es bislang nicht gelungen, aus diesen Pain Points ein funktionierendes Rezept abzuleiten, das funktioniert und das Zeug hat, die Branche nachhaltig wiederzubeleben. Nun habe ich zum ersten Mal seit einigen Jahren die Hoffnung, dass dies gelingen kann – nicht zuletzt durch das 500-Milliarden-Euro- Sondervermögen für die Infrastruktur. Insgesamt ist es aber mehr als das.

Folgende Ebenen sind aus meiner Sicht entscheidend:
1. Bürokratieabbau: Tempo statt Papierkrieg
Die Baubranche braucht dringend Entlastung von überbordender Bürokratie. Genehmigungsverfahren dauern oft länger als der eigentliche Bau. Die Einführung von § 246e BauGB, die Kommunen mehr Flexibilität bei der Genehmigung von Bauprojekten gibt, ist ein vielversprechender Schritt. Doch wir müssen weitergehen: Eine bundesweite Standardisierung digitaler Genehmigungsprozesse, wie sie etwa in Brandenburg mit digitalen Prüftools diskutiert wird, könnte Bauämter entlasten und Verfahren auf Wochen statt Monate verkürzen. Beim Deutschen Baupreis sehen wir, wie innovative Unternehmen solche Lösungen entwickeln. Die Politik sollte solche Technologien flächendeckend einführen.
2. Wohnungsbauziele: Quantität und Qualität vereinen
Die Ampel-Regierung hatte 400.000 neue Wohnungen pro Jahr versprochen – 2024 waren es gerade einmal 251.900. Um diesen Rückstand aufzuholen, braucht es Konzepte zur Nachverdichtung, Aufstockung und die vereinfachte Umnutzung bestehender Gebäude. Quantität allein reicht jedoch nicht: Wir brauchen bezahlbaren, klimafreundlichen und lebenswerten Wohnraum. Das Sondervermögen bietet hier eine große Chance. Mit 23,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau bis 2029 können wir in innovative Baukonzepte investieren – von seriellem Bauen bis hin zu modularen Konstruktionen. Solche Ansätze, die wir regelmäßig beim Deutschen Baupreis auszeichnen, reduzieren Kosten und Bauzeiten, ohne bei der Qualität Abstriche zu machen. Mieten von 15 Euro pro Quadratmeter im Neubau sind ambitioniert, aber machbar – wenn wir auf Standardisierung, digitale Planung und Vereinfachung der Genehmigungsverfahren setzen.
3. Künstliche Intelligenz: Die Baubranche neu denken
Künstliche Intelligenz ist ein Gamechanger für die Baubranche. Von der Planung über die Baustellenlogistik bis hin zur Gebäudewartung bietet KI enorme Potenziale. Beim Deutschen Baupreis sehen wir Projekte, die KI nutzen, um Materialbedarfe präzise zu kalkulieren, Bauzeiten zu optimieren oder energetische Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Ein Beispiel: KI-basierte Software kann Baupläne in Echtzeit auf Normenkonformität prüfen und teure Nachbesserungen vermeiden. Die Politik sollte solche Innovationen fördern, etwa durch gezielte Förderprogramme für Start-ups und Forschungskooperationen. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass kleine und mittelständische Bauunternehmen Zugang zu diesen Technologien bekommen –
etwa durch Schulungsprogramme oder Subventionen für digitale Tools.
4. Sondervermögen: Investitionen klug lenken
Das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz ist ein starkes Signal. Es bietet die finanzielle Rückenstärke, um marode Infrastruktur zu sanieren, neue Wohnungen zu bauen und die Dekarbonisierung voranzutreiben. Doch finanzielle Mittel alleine reichen nicht – es muss auch effizient eingesetzt werden. Die Politik sollte klare Prioritäten setzen: Investitionen in sozialen Wohnungsbau, Förderung nachhaltiger Baumaterialien und die Modernisierung von Schulen, Kitas und Verkehrswegen. Der Deutsche Baupreis zeigt jedes Jahr, wie Unternehmen mit kreativen Lösungen solche Ziele umsetzen. Die Politik sollte solche Best-Practice-Beispiele fördern, etwa durch Wettbewerbe oder Innovationsfonds, die direkt aus dem Sondervermögen gespeist werden.
5. Fachkräftemangel: Talente fördern, Vielfalt stärken
Ohne qualifizierte Fachkräfte bleibt jeder Bauturbo ein Wunschtraum. Die Baubranche leidet unter einem massiven Mangel an Arbeitskräften – von Handwerkern bis hin zu Ingenieuren. Hier braucht es dringend eine Offensive: mehr Ausbildungsplätze, attraktive Arbeitsbedingungen und gezielte Programme, um mehr Frauen und junge Menschen für die Branche zu begeistern. Veranstaltungen wie das Women in Architecture Festival zeigen, wie wichtig Vielfalt ist. Die Politik sollte solche Initiativen unterstützen, etwa durch Stipendien oder Imagekampagnen. Gleichzeitig können digitale Tools wie KI-gestützte Baustellenplanung den Fachkräftemangel abmildern, indem sie Arbeitsprozesse effizienter gestalten. In diesem Zusammenhang kann auch der Einsatz von Robotik auf der Baustelle helfen.
6. Nachhaltigkeit: Bauen für die Zukunft
Klimafreundliches Bauen ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Die Klimaziele des Heizungsgesetzes müssen eingehalten werden. Nachhaltigkeit bedeutet jedoch mehr als energetische Sanierung: Es geht um den Einsatz nachhaltiger Materialien, Kreislaufwirtschaft und die Reduzierung von CO2-Emissionen auf der Baustelle. Beim Deutschen Baupreis erwarten wir auch diesmal wieder beeindruckende Projekte, die zeigen, wie Holz, recycelte Materialien oder 3DDruck das Bauen revolutionieren können. Die Politik sollte Anreize schaffen, etwa durch steuerliche Vergu?nstigungen für nachhaltige Bauprojekte oder die Förderung von Pilotprojekten.
Die Zukunft beginnt jetzt
Ja, die Baubranche steht an einem Scheideweg. Die Herausforderungen sind groß, aber die Chancen überwiegen, wenn Innovation, Mut und Zusammenarbeit Hand in Hand gehen. Jetzt ist die Zeit, den Bauturbo zu zünden: weniger Bürokratie, mehr Technologie, gezielte Investitionen und ein Fokus auf Nachhaltigkeit und Fachkräfte. Als Veranstalter des Deutschen Baupreises rufe ich Politik, Unternehmen und Gesellschaft auf: Lassen Sie uns gemeinsam bauen – für bezahlbaren Wohnraum, lebenswerte Städte und eine starke Zukunft Deutschlands. Die Bagger sind bereit – jetzt müssen sie nur rollen!