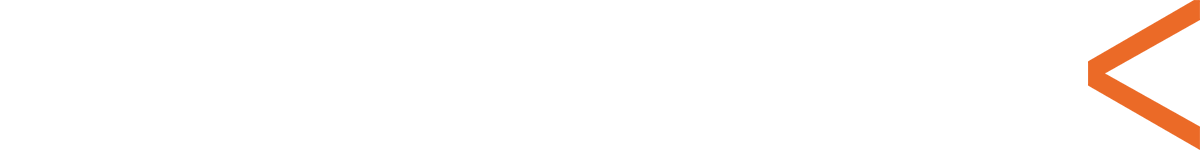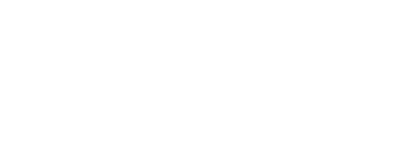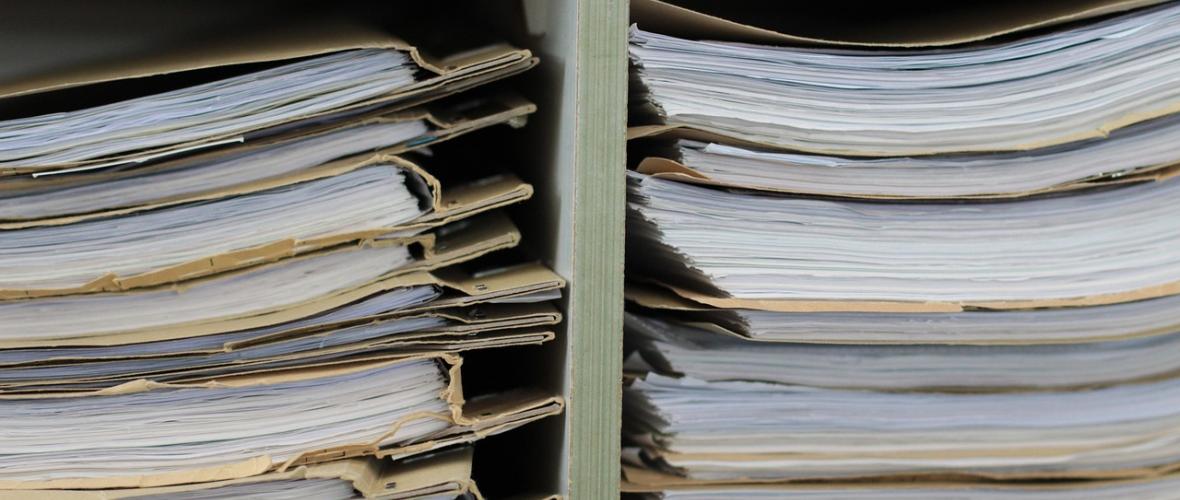Die Stiftung Familienunternehmen hat eine Studie mit dem Titel "Kulturelle Ursachen der Überbürokratisierung" veröffentlicht. Die Erkenntnisse darin sind nicht unbedingt neu, allerdings sehr dicht und strukturiert aufgeführt. Dazu kommen sehr spannende Zahlen, die zeigen, was dieses Thema am Ende kostet.
„Die Überbürokratisierung und Dysfunktionalität am Beispiel des Baurechts und seiner Umsetzung – auf das sich diese Studie exemplarisch konzentriert – sind gekennzeichnet durch zu viele, zu detaillierte, zu komplizierte und teils widersprüchliche Vorschriften.“ So lautet einer der ersten Sätze in einer Studie der Stiftung Familienunternehmen. Ihr Name: "Kulturelle Ursachen der Überbürokratisierung".
Die heutige Überregulierung ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung: Seit 75 Jahren haben EU, Bund, Länder und Kommunen fortlaufend neue Vorschriften geschaffen. Die Komplexität wächst zusätzlich, weil sich die einzelnen Rechtsbereiche weitgehend unabhängig voneinander entwickelt haben. Das Zusammenspiel zwischen der Gesetzgebung auf europäischer und Bundesebene und dem Verwaltungsvollzug auf Länder- und Kommunalebene funktioniert kaum.
Nahezu alle Empfehlungen weisen deshalb auf die Notwendigkeit eines tiefgreifenden Kulturwandels in Verwaltung und Ministerien hin: Weg von Absicherung und Misstrauen, hin zu Vertrauen und Eigenverantwortung. Nicht die Angst vor Fehlern sollte leitend sein, sondern die Fähigkeit, Folgen eigenständig abzuwägen. Entscheidend ist weniger das starre Festhalten am Wortlaut des Gesetzes als vielmehr die Orientierung an dessen Zweck. Ein weiterer Grund für die stetig wachsende Regelungsdichte liegt im hohen Erwartungsniveau der Bevölkerung an umfassende Schutzstandards – vom Brandschutz bis zum Klimaschutz. Diese Anforderungen werden häufig durch Klagen von Interessengruppen verstärkt, sodass die Politik unter Druck gerät, immer neue Regelungen zu erlassen. Um Verfahren zu beschleunigen, muss der Gesetzgeber eine klare Priorisierung der Schutzgüter vorgeben. Verbleibende Konflikte sollten an runden Tischen verhandelt und pragmatisch gelöst werden.
Die Lösungen kommen sehr einfach daher: Die Silo-Mentalität in Behörden lässt sich überwinden, wenn horizontale Koordination fest verankert wird – etwa durch projektorientierte Arbeitsformen und regelmäßige Austauschformate. Parallel dazu sollte die Aus- und Weiterbildung stärker auf ein breites Verständnis setzen, um mehr Generalisten statt reiner Spezialisten auszubilden. Job-Rotationen innerhalb der Behörde sowie Praktika in der Privatwirtschaft können zusätzlich das gegenseitige Verständnis fördern. Auch die frühzeitige Beratung von Bauherren und Planern vor der Antragstellung trägt dazu bei, Genehmigungsverfahren auf beiden Seiten zu beschleunigen.
Sehr wichtiger Punkt: Grundsätzlich sollte den Bürgern wieder mehr Eigenverantwortung zugemutet werden. Der Staat kann nicht jedes individuelle Risiko absichern. Einzelne nicht vollständig berücksichtigte Fälle oder ein gewisses Maß an Missbrauch seien hinzunehmen – die Kosten der Überbürokratisierung sind deutlich höher. Und: „Die Dominanz der Regelorientierung in der Vollzugsverwaltung kann verringert werden, wenn in der Rechtsetzung bereits darauf geachtet wird, dass mit Hilfe von mehr Ermessensregeln und weniger detaillierte Vorgaben möglichst viel Handlungsspielraum eingeräumt wird. Vor allem muss den Mitarbeitern in den Ministerien für die Gesetzesvorbereitung mehr Zeit eingeräumt werden.“
Ein echter Kulturwandel zu Eigenverantwortung, Pragmatismus und Ergebnisorientierung setzt zudem voraus, dass Behördenleitungen Verantwortung übernehmen: Sie müssen ihren Mitarbeitern Rückhalt geben, eine konstruktive Fehlerkultur fördern und die Angst vor den Konsequenzen eigenständigen Handelns nehmen. Dazu ist eine gezielte Qualifizierung von Führungskräften notwendig.
Nicht zuletzt erfordert der Perspektivwechsel bei Normgebern und Normanwendern eine Reform der Ausbildungs- und Weiterbildungssysteme. Breiter angelegte Studiengänge, verpflichtende Praxisphasen, neue Rekrutierungs- und Beförderungskriterien sowie ein flexibleres Dienstrecht, das Wechsel zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft erleichtert, können entscheidende Impulse setzen.
Die wahrgenommene Entwicklung der bürokratischen Belastung seit 2021 steigt laut der Studie stetig. Der Nationale Normenkontrollrat hat in seinem Jahresbericht 2023 einen beispiellosen Anstieg des sogenannten Erfüllungsaufwandes festgestellt: Um rund 9,3 Milliarden Euro auf insgesamt 26,8 Milliarden Euro – ein Plus von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit summiert sich die Bürokratiebelastung der Wirtschaft durch Bundesregelungen inzwischen auf über 65 Milliarden Euro, Haupttreiber im Jahr 2023 war das Gebäudeenergiegesetz. Auch das am 23. Oktober 2024 in Kraft getretene Bürokratieentlastungsgesetz IV lässt kaum auf spürbare Verbesserungen hoffen. Erfahrungen mit früheren Entlastungs- und Beschleunigungsgesetzen zeigen, dass deren Wirkung oft begrenzt blieb.
Das Dilemma: Entbürokratisierung sollte selbst nicht bürokratisch betrieben werden, wird sie aber.
Hier geht es zur kompletten Studie