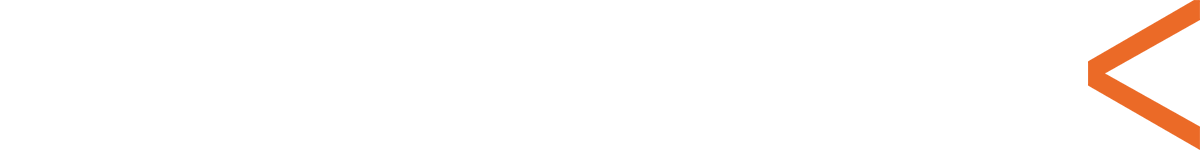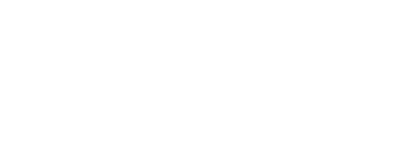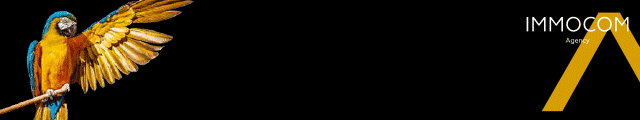Was bedeutet der Bauturbo konkret für den geförderten Wohnbau und insbesondere für das genossenschaftliche Bauen? Dr. Christina Lupprian von Korten Rechtsanwälte hat sich das für IMMOBILIEN AKTUELL detailliert angeschaut.
Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau in Deutschland haben sich in den letzten Jahren verändert. Baukosten, komplexe Genehmigungsverfahren und eine wachsende regulatorische Dichte haben den Markt vielerorts zum Stillstand gebracht. In diesem Spannungsfeld sind kommunale und gemeinwohlorientierte Träger wie Baugenossenschaften besonders betroffen. Sie können sich meistens keine langwierigen Verfahren oder kostspielige Nachbesserungen leisten. Und inmitten dieser Phase verzögerter Bauprojekte steigt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum weiter. Das trifft längst nicht nur die Städte und Metropolregionen, sondern auch das Umland.
Vor diesem Hintergrund markiert das Anfang Juni 2025 verabschiedete Gesetzespaket zur Beschleunigung des Wohnungsbaus , das wir alle als Bauturbo kennengelernt haben, einen Paradigmenwechsel: Erstmals schafft der Bund nicht nur Anreize, sondern auch verbindliche rechtliche Rahmenbedingungen für schnellere Verfahren, klarere Zuständigkeiten und damit mehr Planungssicherheit. Doch was bedeutet das konkret für den geförderten Wohnbau und insbesondere für das genossenschaftliche Bauen?
Ein neuer rechtlicher Rahmen mit konkretem Nutzen
Kernstück des Pakets ist der neue §?246e Baugesetzbuch, der es Kommunen erlaubt, für bestimmte Vorhaben deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren einzuführen. Davon profitieren vor allem Projekte, die auf Aufstockung, Nachverdichtung oder Umnutzung von Bestandsflächen setzen – also genau dort ansetzen, wo genossenschaftliche Initiativen besonders aktiv sind. Das Verfahren soll künftig nicht länger Jahre dauern, sondern binnen zwei Monaten abgeschlossen sein. Als Voraussetzung muss die Kommune es jedoch entsprechend anwenden und es sollte sichergestellt sein, dass das Vorhaben den vereinfachten Prüfkriterien genügt.
Wichtig: Diese neue Möglichkeit steht nicht automatisch zur Verfügung. Die Entscheidung liegt weiterhin bei der Gemeinde, die den Einsatz des „Bauturbo“ aktiv beschließen muss. Insofern ist der Erfolg der Regelung stark von der lokalen politischen Steuerung abhängig. Dennoch erhalten Kommunen nun erstmals die rechtliche Möglichkeit, überholte Verfahrensroutinen zu verlassen und auf schlankere Prozesse umzuschalten ohne rechtliche Unsicherheiten befürchten zu müssen.
Flankierend wurde der Schutz vor Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in angespannten Märkten verlängert. Diese Maßnahmen senden ein klares Signal: Der Gesetzgeber will bezahlbaren Mietwohnraum nicht nur fördern, sondern auch dauerhaft absichern.
Warum Genossenschaften besonders profitieren
Für genossenschaftlich organisierte Träger ist diese Entwicklung ein echter Fortschritt. Schließlich verfügen sie selten über große Rechtsabteilungen oder interne Projektentwickler. Stattdessen sind sie auf rechtliche Verlässlichkeit und planbare Verfahren angewiesen. Der neue Rechtsrahmen erleichtert genau das: schnellere Entscheidungen, klarere Zuständigkeiten, verbindlichere Zeitachsen.
Hinzu kommt, dass Genossenschaften für eine wirtschaftliche Umsetzung der Bauziele prädestiniert sind: Sie denken in Jahrzehnten, nicht in Investitionszyklen. Das macht sie besonders geeignet für Kooperationen mit Kommunen, wenn es um sozialverträgliche Quartiersentwicklung geht. Der „Bauturbo“ kann hier als Katalysator wirken: Wenn Förderprogramme, kommunale Grundstückspolitik und beschleunigte Genehmigungsverfahren zusammenspielen, eröffnen sich neue Handlungsspielräume für genossenschaftliche Initiativen.
Serielles und modulares Bauen als Verstärker
Die aktuellen Entwicklungen lassen sich außerdem gut mit seriellem Bauen verknüpfen, also mit Typengenehmigungen, vorgefertigten Modulen oder standardisierten Planungsprozessen. Gerade im genossenschaftlichen Kontext kann das helfen, Kosten zu senken und Projekte schneller umzusetzen. Mehrere Kommunen denken bereits darüber nach, gemeinsame Typenbibliotheken zu entwickeln oder überregionale Musterverfahren zu erproben.
So entsteht ein Bauumfeld, in dem genossenschaftliche Träger nicht länger in Einzellösungen denken müssen, sondern sich mit rechtlicher Rückendeckung und reduzierten Risiken auf praxiserprobte Verfahren stützen können.
Prognose: Mehr Dynamik im genossenschaftlichen Bauen
Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass sich das genossenschaftliche Bauen in den nächsten Jahren spürbar beleben wird. Wie oben erwähnt kann das gelingen, wenn Städte und Kommunen ihre neuen Handlungsspielräume aktiv nutzen. Dafür spricht, dass das Vertrauen in langfristig stabile Wohnformen steigt, während gleichzeitig der politische Rückhalt für gemeinwohlorientierte Trägerschaften steigt. Inzwischen denken auch ländliche Regionen darüber nach, Genossenschaften gezielt durch vergünstigte Erbbauverträge, Konzeptvergaben oder integrierte Quartiersstrategien zu fördern.
Besonders dynamisch dürfte sich der Markt dort entwickeln, wo sich klassische Projektentwickler wegen gestiegener Kosten zurückziehen: In urbanen Lagen mit angespanntem Wohnungsmarkt, in denen sich kleinere Grundstücke oder Bestandsgebäude besser für genossenschaftliche Träger eignen als für großvolumige Investorenvorhaben.
Auch hybride Modelle wie etwa Kooperation mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften oder gemeinnützigen Trägern könnten an Bedeutung gewinnen. Die juristische Klarheit, die der „Bauturbo“ bringt, senkt Schwellenängste und macht neue Partnerschaften wahrscheinlicher.
Der neue Rechtsrahmen ersetzt keine Förderung und keine Baufinanzierung. Er bildet aber eine notwendige Grundlage dafür, dass Fördergelder wirken können. Denn ohne schnelle Genehmigung, verlässliche Zeitpläne und überschaubare Risiken bleibt selbst das beste Modellprojekt nur ein Papiertiger. Auf der einen Seite sollten Genossenschaften die neuen Chancen deshalb aktiv nutzen. Und auf der anderen Seite sollten Kommunen gezielt auf sie zugehen. Der „Bauturbo“ kann greifen, wenn alle Beteiligten ihn auch wirklich zünden.
Über die Autorin
Dr. Christina Lupprian ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt im Bau-, Immobilien- und Gesellschaftsrecht. Sie studierte in Hamburg, Mainz und San Diego und promovierte im öffentlichen Wirtschaftsrecht. Nach Stationen als Associate und Partnerin in international tätigen Großkanzleien sowie spezialisierten Boutique-Kanzleien machte sie sich mit Fokus auf immobiliennahe Wirtschaftsthemen, erneuerbare Energien und Projektstrukturierung selbstständig. Seit Juli 2024 verstärkt sie das Team von Korten Rechtsanwälte als Ansprechpartnerin für die rechtliche Begleitung komplexer Bau- und Immobilienprojekte.