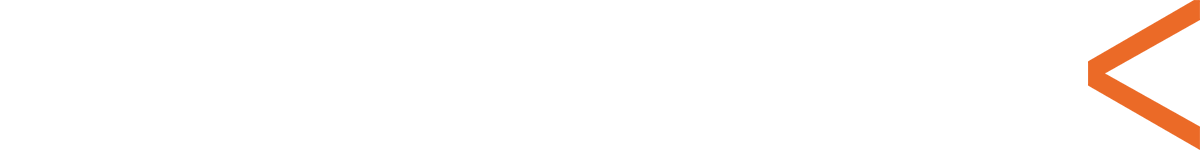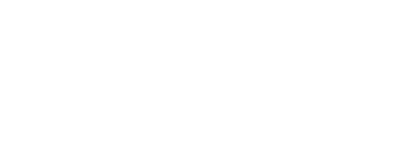Berlin bleibt ein Labor für Regulierungsexperimente im Wohnungsmarkt. Zwischen Zweckentfremdungsverbot, Milieuschutz und politischen Quotenwünschen geraten Eigentümer und Investoren zunehmend unter Druck. Uwe Bottermann, Rechtsanwalt und Partner bei Bottermann::Khorrami, beobachtet seit Jahren aus der Praxis, wie weit die Eingriffe inzwischen reichen, welche rechtlichen Folgen drohen und warum selbst alltägliche Prozesse wie Sanierungen oder die Vermietung möblierter Wohnungen zur juristischen Stolperfalle werden. In seinem Blick nach vorn geht es um die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr, mögliche Verschärfungen für Vermieter und Bestandshalter sowie die Frage, ob Berlin seine Attraktivität für internationale Investoren trotz dieser Gemengelage behalten kann.
IMMOBILIEN AKTUELL (IA): In Berlin werden seit Jahren neue Regulierungen eingeführt – vom Mietendeckel bis zum Zweckentfremdungsverbot. Haben Sie eine Hitliste? Was beschäftigt derzeit Investoren am meisten von dieser Hitliste?
Uwe Bottermann (UB): Ganz oben steht bei uns derzeit das Zweckentfremdungsverbot, weil es beispielsweise Sanierungen deutlich erschwert. Eine Wohnung während der Zeit der Sanierung längere Zeit leer stehen zu lassen, ist ohne Genehmigung rechtswidrig. Ebenso schwierig ist die Situation bei neuen Eigentumswohnungsprojekten. Auch hier drängen die Bezirksämter nach drei Monaten auf die Vermietung fertiggestellter Wohnungen, obgleich der Bauträger eigentlich an Selbstnutzer verkaufen will. Unverständlich wird es bei der Vermietung möblierter Wohnungen in Milieuschutzgebieten. Hier soll nach Auffassung einiger Bezirke im Falle einer vorübergehenden Vermietung eine Änderung der Nutzungsart vorliegen, die dann vom Bezirk hätte genehmigt werden müssen. Dabei wird doch die Wohnung weiter als Wohnung genutzt.
IA: Mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr: Welche rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen erwarten Sie für Vermieter und Bestandshalter, falls es zu einer stärkeren Linksverschiebung kommt?
UB: Auch ohne Regierungswechsel wird die Diskussion um Mieten und Wohnen an Dynamik gewinnen und neue Restriktionen dürften kommen. Das Thema Wohnen wird den Wahlkampf maßgeblich bestimmen, denn 85 Prozent der Wählerhaushalte sind Mieterhaushalte. Wir sehen schon in den Positionspapieren, was auf Vermieter und Bestandshalter zukommen könnte. Das sind oftmals politische Versprechungen, die sich rechtlich allenfalls schwer halten lassen werden. Die Berliner Grünen wünschen sich beispielsweise, dass Vermieter*innen von 50 bis 100 Wohnungen fünf Wohneinheiten nach WBS-Kriterien vermieten müssen. Bei über 100 Wohneinheiten werden es zehn Prozent, ab 1.000 Wohneinheiten werden es 25 Prozent und ab 2.000 Wohneinheiten 30 Prozent sein. Und die LINKE schlägt vor, dass Vermieter mit 50 bis 500 Wohnungen 30 Prozent ihrer freiwerdenden Wohnungen zu bezahlbaren Mieten an Menschen mit geringen oder mittleren Einkommen vergeben. Für Unternehmen mit 501 bis 1.000 Wohnungen plant die Linke eine Quote von 40 Prozent, für noch größere Vermieter 50 Prozent. Letztere sollen zudem dazu verpflichtet werden, zehn Prozent der Wohnungen innerhalb der Sozialquote an Wohnungslose zu vergeben.
IA: Eigentümer stehen in Berlin zunehmend zwischen politischen Eingriffen und wirtschaftlichen Zwängen. Welche rechtlichen Strategien haben sich in der Praxis bewährt, um Investitionen trotzdem abzusichern?
UB: Stoik und Durchhaltevermögen. Es bleibt zunächst wenig übrig, als die Situation als gegeben anzunehmen. Ausweich- oder Umgehungsgestaltungen sind nicht empfehlenswert. Denn wer gegen (auch fragwürdige) Regulierung verstößt, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Dennoch sollte man sich als Eigentümer immer überlegen, ob es sich gegebenenfalls lohnt, den Rechtsweg zu beschreiten. Das Land Berlin setzt in der Regel darauf, dass Eigentümer nachgeben oder wenigstens den Kompromiss suchen, selbst wenn seine Regelauslegung rechtlich zweifelhaft sein sollte. Denn oftmals bekommen Kläger erst bei den Bundesgerichten Recht, wie die Beispiele Vorkaufsrecht und Mietendeckel zeigen.
IA: Ein weiteres Streitfeld ist die Bewertung von Immobilien durch Finanzämter bei Erbschaften und Schenkungen. Wie groß ist die Diskrepanz zwischen Steuerwerten und Verkehrswerten aktuell – und welche Möglichkeiten gibt es, überhöhte Steuerforderungen abzuwehren?
UB: Wie groß die Diskrepanz zwischen den Immobilienwerten, die das Finanzamt ansetzt, und den tatsächlichen Verkehrswerten aktuell ist, lässt sich pauschal nicht beantworten. Doch die Diskrepanz ist häufig erheblich. Was bei der Bewertung des Finanzamtes häufig fehlt: eine individuelle Bewertung des baulichen Zustandes, der Energieeffizienz oder möglicher Mängel. Es wird pauschaliert – und oft zu hoch angesetzt. Was dabei häufig fehlt: eine individuelle Bewertung des baulichen Zustandes, der Energieeffizienz oder möglicher Mängel. Eine eingewachsene 1970er-Jahre-Doppelhaushälfte mit Ölheizung kann damit plötzlich wie eine energetisch sanierte Stadtvilla in bester Lage behandelt werden. Erben oder Beschenkte müssen einen überhöhten Wertansatz des Finanzamtes nicht blind akzeptieren. Sie haben das Recht, ein eigenes Verkehrswertgutachten einzuholen – und sollten das insbesondere in folgenden drei Fällen tun: erstens, wenn das Objekt nicht modernisiert oder sanierungsbedürftig ist, zweitens es sich um eine überdurchschnittlich große Immobilie mit Lageproblemen handelt, drittens, wenn der amtlich angesetzte Wert spürbar über dem Marktwert liegt. Wichtig ist, dass das Gutachten ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger oder ein zertifizierter Immobiliengutachter erstellen sollte. Kurzbewertungen aus dem Internet oder Maklerexposés reichen nicht aus.
IA: Wir schließen die Klammer: Internationale Investoren beobachten den Berliner Markt sehr genau. Welche Auswirkungen haben die hiesigen Regulierungen auf die Attraktivität des Standorts und welche Lehren ziehen andere Bundesländer daraus?
UB: Investmentberater und Makler beraten kaufinteressierte Investoren zunehmend auch in Bezug auf die hiesigen politischen und rechtlichen Risiken. Die vom Land Berlin erdachten Restriktionen sind – wie der Mietendeckel – allerdings oft nur von geringer Haltbarkeit. Doch sollten sich Käufer darauf einstellen, dass sie ihre Investitionsziele eventuell zeitlich verzögert erreichen. Dass die Landespolitik die Attraktivität des Immobilienstandortes insgesamt und nachhaltig mindert, glaube ich allerdings nicht. Berlin ist einer der größten und liquidesten Wohnungsmärkte in Europa und wird bei auf Diversifizierung abzielenden Investitionsstrategien immer eine Rolle spielen. Zudem dürfte es nicht gelingen, die Lücke zwischen Bedarfs- und Angebotswachstum auf absehbare Zeit zu schließen, so dass es auch weiterhin ein hinreichendes Mietanpassungspotenzial und eine hohe Vermietungssicherheit geben wird. Im Vergleich zum Neubau immer günstigerer Wohnungsbestand wird daher auch weiterhin von internationalen Investoren nachgefragt werden. Andere Länder werden Rechtsauslegungen übernehmen, die in Berlin erfolgreich angewandt werden. Das zeigt das Beispiel des Milieuschutzes. Alle Top-7-Standorte sowie Leipzig und Dresden haben inzwischen Soziale Erhaltungssatzungen. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass die Stadt Düsseldorf mal eine Idee der Kreuzberger Grünen übernehmen würde.